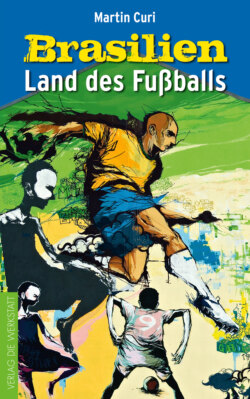Читать книгу Brasilien - Martin Curi - Страница 43
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1998: Dramatik um Ronaldo
ОглавлениеSchon während der 1980er Jahre hatte sich eine Entwicklung angebahnt, die bestimmend für die künftigen Diskussionen sein sollte. Immer mehr brasilianische Athleten wechselten für viel Geld zu europäischen Vereinen und bezogen dort ein deutlich höheres Einkommen, als es bei Klubs in Brasilien möglich war. Der Fußball wurde zum durchkommerzialisierten Business. Von den 22 brasilianischen Spielern, die 1994 zur WM berufen worden waren, spielten schon nur noch zehn im eigenen Land. 1998 sank diese Zahl sogar auf acht.
Es gab in Brasilien einmal eine Zeit, in der Spieler, die im Ausland tätig waren, nicht in die Nationalmannschaft berufen werden durften. Die großen Fragen waren stets gewesen: „Bis zu welchem Grad kann man Heimatliebe erkaufen? Bis zu welchem Grad widersteht diese Liebe dem Lockruf des Geldes? Wenn so viele Spieler ihrer Heimat des Geldes wegen den Rücken kehren, dann könnte es ja möglich sein, dass sie auch die Nationalmannschaft für Geld wechseln.“ Bei der WM 1998 in Frankreich sollte diese Diskussion ins Zentrum rücken.
Ronaldo am Boden – nach dem Endspiel 1998 brodelte die Gerüchteküche.
Brasilien gehört zwar immer zu den WM-Favoriten, doch 1998 galt zumindest in Europa Gastgeber Frankreich als Topfavorit auf den Titel. In Brasilien wurde das allerdings anders gesehen. Dort ist Frankreich berühmt für seine Philosophen, die schönen Künste und den guten Wein, nicht aber für Fußball. Außerdem trat die Seleção als Titelverteidiger an und hatte den neuen Shootingstar des Weltfußballs in seinen Reihen: Ronaldo Fenômeno. Die Erwartungen waren hoch.
Dementsprechend tief war der Fall, als sich Brasilien im Finale den „Winzern“ aus Frankreich mit 0:3 geschlagen geben musste. Es war die höchste WM-Niederlage Brasiliens überhaupt. Dieses Spiel markiert das dritte große nationale Trauma nach 1950 und 1982 und fügte dem Buch der Niederlagen ein weiteres Kapitel hinzu, das ausgiebig diskutiert wurde und wird. Ich habe schon mehrfach Brasilianer getroffen, die mir gesagt haben: „Ich schaue keinen Fußball mehr; seit 1998 glaube ich nicht mehr daran. Es ist doch alles nur gekauft.“
Mich verblüffen derlei Aussagen, denn sie unterstellen, Brasilien wäre der große Favorit gewesen, der nur durch ein korrumpiertes Spiel um den WM-Titel gebracht worden sei. Dem war aber keineswegs so. Es mag sein, dass Frankreich kein brillantes Turnier spielte, aber immerhin hat es sämtliche Spiele gewonnen. Im Gegensatz zu Brasilien, das durch pomadige Spielweise im Vorrundenspiel gegen Norwegen verloren hatte. Wie war es also möglich, dass das Finale von Paris zu einem derart traumatischen Erlebnis wurde?
Zentral für die Klärung dieser Frage sind die seltsamen Ereignisse rund um Ronaldo in den Stunden vor dem Finale. Laut seinen Mannschaftskollegen erlitt er kurz vor der Mittagsruhe eine Art epileptischen Anfall. Die Spieler riefen umgehend einen Arzt, der Ronaldo ins Krankenhaus begleitete. Nichts hatte im Übrigen zuvor auf das Auftreten solcher Krämpfe hingedeutet.
Die Nachricht von Ronaldos Erkrankung erreichte die brasilianische Öffentlichkeit erst kurz vor dem Finale und stürzte das Land in einen Zustand tiefster Verzweiflung. Etwa 30 Minuten vor dem Spiel verkündete ein sichtlich geschockter Kommentator, Ronaldo würde nicht spielen. Zum Anpfiff stand er dann aber doch auf dem Feld. Trainer Zagallo sagte später in einem Interview, dass sich Ronaldo selbst für spielfähig erklärt habe und er deshalb auch aufgestellt worden sei. Was hätte Zagallo auch anderes tun sollen? Hätte er Ronaldo nicht auflaufen lassen, hätte man diese Entscheidung auch kritisiert.
Ronaldo spielte ein katastrophales Finale und wurde ein Teil der Niederlage. Die meisten Brasilianer glauben nicht, dass Ronaldo epileptische Krämpfe gehabt hat. Stattdessen wird spekuliert, der Staat Frankreich oder Ausrüster Nike, mit dem Ronaldo einen Individualvertrag abgeschlossen hatte, hätten das Spiel gekauft. Das mag bizarr klingen, wurde aber tatsächlich in den brasilianischen Medien so vertreten.
Der Staat Frankreich ist ein Verdächtiger, da er aus politischen Gründen sein Image aufpolieren wollte und deshalb das Spiel kaufen musste. Diese These mag sogar ansatzweise einleuchten. Wird aber aufgerechnet, wie viel die Spieler, Trainer und Betreuer bei einem Titelgewinn verdient hätten (es geht um mehrfache Millionen-Euro-Beträge), klingt sie eher unwahrscheinlich. In der Diskussion wird vielmehr der Gegensatz zwischen den reichen Europäern, die schon immer ihre Kolonien ausnutzten, und dem ausgebeuteten Dritte-Welt-Land Brasilien thematisiert. Nur wer das Bild von diesem krassen Gegensatz im Kopf hat, kann ernsthaft an diese Theorie glauben.
Im Fall des Unternehmens Nike stellt sich die Frage, welchen Nutzen der Ausstatter hat, wenn die von ihm geförderte Mannschaft verliert. Zudem dürfte Nike ein großes Interesse daran gehabt haben, dass sein wichtigster Star, Ronaldo, auf dem Platz steht. Daraus kann geschlossen werden, dass Ronaldo tatsächlich wegen Gesundheitsproblemen nicht hätte spielen dürfen und er möglicherweise auf Druck von Nike und entgegen dem Rat der Ärzte dann doch aufgestellt wurde. Auch für dieses Szenario ergibt sich allerdings die Frage, welchen Sinn es macht, eine Werbefigur in schlechter Verfassung zur Schau zu stellen.
All diese Theorien haben eines gemeinsam: Sie reflektieren die brasilianische Angst, eine mysteriöse, ausländische Kraft könnte ihren Fußball korrumpieren. In letzter Konsequenz ist an dieser Stelle sogar die nationale Souveränität in Gefahr. Deshalb wurde ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss einberufen, um die Vorgänge zu untersuchen. Denn: Fußball ist Staatseigentum, und wenn er bedroht ist, fällt der Regierung die Aufgabe zu, ihn zu beschützen. Vor diesem Ausschuss mussten sowohl Zagallo als auch Ronaldo aussagen, ohne dass es zu einem nennenswerten Resultat kam.
Im Übrigen schürte die französische Nationalmannschaft andere brasilianische Ängste, denn auf französischer Seite standen mit Spielern wie Djorkaeff, Zidane oder Vieira Athleten mit Migrationshintergrund, die in Brasilien nicht als echte Franzosen wahrgenommen wurden. Diese Spieler müssten nach brasilianischer Ansicht eigentlich für andere Nationen auftreten, würden aber für Geld die französischen Farben verteidigen. Sie hätten also ihre Heimatliebe verkauft. Viele Brasilianer befürchten Ähnliches von ihren Spielern, und Fälle wie Paulo Rink, Kuranyi oder Cacau bestärken diese Angst.