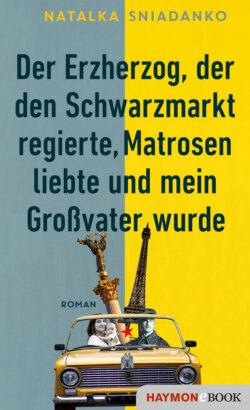Читать книгу Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde - Natalka Sniadanko - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das geheime Leben im Schloss
ОглавлениеWilly liebte es, das geheime Leben im Schloss zu beobachten, das nicht in den auf Hochglanz geputzten, ziemlich langweiligen Paradezimmern und auch nicht in den Gemächern der Familie stattfand, sondern dort, wo die Bediensteten ihrer Arbeit nachgingen. Die Wäscher erinnerten Willy an mächtige Riesen: Leichthändig leerten sie die gigantischen Waschzuber aus, Dampf stieg auf und erfüllte den Raum mit einem geheimnisvollen Nebel und Feuchtigkeit, dann schrubbten sie die Wäsche flink auf dem Waschbrett, lachten dabei fröhlich und schwatzten ununterbrochen – auch dazu reichte ihre Kraft. Lange Zeit war Willy überzeugt, dass es diese Wäscher waren, die in Marmor verewigt von unten die Balkone stützten. Ebenso allmächtig und kräftig erschienen ihm die Büglerinnen, die mit ihren gusseisernen Bügeleisen auf den Hof hinausliefen und sie in der Luft schwenkten, um die Kohle darin abzulöschen. Aus den halbrunden Öffnungen des Eisens spritzten nach allen Seiten Funken, wie von den Kerzen auf dem Weihnachtsbaum.
Die Köchinnen und ihre Helferinnen waren echte Zauberinnen, sie arbeiteten in der Küche wie gut aufeinander abgestimmte Maschinen. Die unglaubliche Anzahl an Aufgaben, die sie täglich verrichteten, konnte man nur beurteilen, wenn man sie aus nächster Nähe beobachtete: Wie sie sich bei ihrer Arbeit mit maximaler Konzentration bewegten, bei der jede falsche Bewegung eine Speise verderben, jeder ungeschickte Handgriff einen Teller aus der Hand schlagen und jedes nicht zeitgerechte Vom-Feuer-Nehmen eine Katastrophe bedeuten konnte, nämlich dass etwas anbrannte oder roh blieb. Wenn Willy sich heimlich in die Küche schlich, versteckte er sich im hintersten Winkel, nicht nur, weil er sofort ins Kinderzimmer zurückgebracht worden wäre, wenn man ihn entdeckt hätte, sondern auch aus Angst, er könnte stören, im Weg stehen, diese Harmonie trüben, die ihm noch vollkommener erschien als das mechanische Zusammenspiel der Einzelteile seiner Spielsachen. Er musste sich beherrschen, um vor Ekel nicht aufzuschreien, wenn er sich Aug in Aug mit einem grinsenden Schweinekopf wiederfand oder aus nächster Nähe einen Teller mit unappetitlichen rohen Innereien sah. Ebenso widerstand er der Versuchung, den Finger in den Marmeladeschaum zu stecken, nach dem er nur den Arm hätte ausstrecken müssen. Marmeladeschaum – bekanntlich die beste Leckerei der Welt – sein Leben ist kurz, er trocknet ein und verwandelt sich in Zuckerkristalle. Die Marmelade, von der er abgeschöpft wird, schmeckt dagegen längst nicht so luftig wie der Schaum selbst.
Im Schloss arbeitete ein polnisches Kindermädchen, das Stephans Kinder behandelte wie ihre eigenen. Besser gesagt, wie sie ihre eigenen behandelt hätte, wenn sie welche gehabt hätte. Sie war ungewöhnlich klein, hatte einen ziemlich großen Buckel und ein rundes Gesicht mit feinen Zügen, eine Stupsnase, rote Wangen und glatt nach hinten frisiertes Haar. Das Kindermädchen litt an einer seltenen Gelenkserkrankung, bei der sie von Zeit zu Zeit unerträgliche Schmerzen in Rücken und Beinen bekam, gegen die keine Medikamente halfen. Die Schmerzattacken waren so heftig, dass das Kindermädchen ohnmächtig zu Boden fiel. Bei einem dieser Stürze hatte sie sich schwer an der Wirbelsäule verletzt und einen Buckel bekommen.
Karl Stephan bestellte bei einem Wiener Orthopäden ein Eisenkorsett, das ihr das Gehen erleichtern sollte. Willy half dem Kindermädchen manchmal die Treppe hinunter, wenn sie von einer Schmerzattacke überrascht wurde. Doch Karl Stephans Angebot, sie könne eine leichtere Arbeit ausüben oder sich mit einer kleinen Pension, die ihr die Habsburger lebenslänglich auszahlen würden, im Dorf niederlassen, lehnte sie kategorisch ab.
Das Kindermädchen liebte ihre Zöglinge. Und sie hatte alle gleich lieb, im Unterschied zur Mutter, die ihren jüngsten Sohn bevorzugte. Manchmal war das so offensichtlich, dass sich die anderen Kinder Streiche für Wilhelm ausdachten. Der kleine Albrecht legte Wilhelm einmal eine schmutzige Kröte unter das Kopfkissen, ein anderes Mal eine vermeintliche Ringelnatter, die sich später als Kreuzotter mit einem eingetrockneten weißen Fleck auf dem Kopf entpuppte, weshalb Albrecht sie für eine Ringelnatter gehalten hatte. Zum Glück passierte nichts, doch fühlte sich Albrecht von diesem Zeitpunkt an seinem Bruder gegenüber unbewusst schuldig. Vielleicht zahlte er Wilhelm später deshalb gegen den Willen des Vaters jahrelang Dividenden aus der Bierbrauerei der Familie. Das Kindermädchen war der Meinung, dass Maria Theresia nichts von Kindererziehung verstand, und ignorierte deshalb alle Verbote zu naschen, Wasser aus dem Fluss zu trinken, Freundschaft mit Dorfkindern zu schließen, und vor allem die Anordnung, den Kindern jeden Tag weiße Strümpfe anzuziehen.
„In weißen Strümpfen durch den Wald laufen ist eine Verhöhnung“, murmelte das Kindermädchen vor sich hin. „Nicht nur für die Kinder, auch für die Wäscher – das sind auch Menschen! Die Kinder sollen barfuß laufen, Weiß werden sie noch genug tragen.“
Immer, wenn Maria Theresia sah, dass ihre sechs Kinder bis zu den Ohren mit Matsch bespritzt gemeinsam mit den Dorfkindern und den Kindern der Diener in einer Schlammpfütze spielten, wurde ihr übel. Sie war überzeugt, dass man Kinder mit Sauberkeit und ästhetisch erlesenem Interieur umgeben sollte, damit sie ein Gefühl für Schönheit entwickelten. Karl Stephans Ansichten über Erziehung waren pragmatischer, er schätzte das Kindermädchen sehr für ihre Hingabe den Kindern gegenüber und dafür, dass sie von ihr lebendiges Polnisch lernten. Demnach wollte er nichts von einer Einschränkung ihrer Kompetenzen hören.
Das Kindermädchen bewohnte eine winzige Kammer neben den Schlafzimmern der Kinder. Jede Nacht stand sie einige Male auf und lauschte an den Türen, ob auch alles in Ordnung war. Als die Kinder klein waren, richtete sie ihnen die Decke oder machte das Nachtlicht aus.
Manchmal bekam das Kindermädchen Besuch von ihren zahlreichen Freundinnen im Dorf. Meist saßen sie im Zimmer des Kindermädchens, das schon Tage im Voraus verschiedenste Speisen zubereitete, um die Dorffrauen mit für sie seltenen Leckereien zu verwöhnen. Wenn Stephan erfuhr, dass das Kindermädchen Besuch bekam, ließ er ihr stets eine Flasche Wein oder Likör bringen. Einmal brachte er die Flasche sogar selbst ins Zimmer des Kindermädchens. Er betrat den halbdunklen Raum, in dem nur ein paar Kerzen brannten, und sah vier Frauen um einen mit Speisen überquellenden Tisch sitzen und weinen. Er fragte verwundert, was los sei.
„Nichts“, antwortete das Kindermädchen und seufzte. „Uns war einfach nach Weinen. Wir haben so lange nicht miteinander geweint.“
Die Dorffrauen fanden immer einen Grund zu weinen. Oft kam eine von ihnen völlig verschwollen und mit blauen Flecken im Gesicht zum Kindermädchen, nachdem ihr Mann sie im Suff geschlagen hatte, und blieb sogar über Nacht, aus Angst, er könnte sie totschlagen. Fast jeden Winter verlor eine der Freundinnen ein Kind, weil es sich erkältet hatte. Sie hatten Aborte, Entzündungen, Krankheiten, sie arbeiteten schwer, auf dem Feld und zu Hause, lebten in ständiger Angst vor Unwettern, Missernten, Strafen Gottes und ihren Männern. Es gab so oft Grund zu weinen, dass sie keine Zeit hatten, jede einzelne Gelegenheit zu nutzen. Also kamen sie hin und wieder an einem angstfreien Ort zusammen und weinten über alles auf einmal und im Voraus. Danach war ihnen leichter zumute.