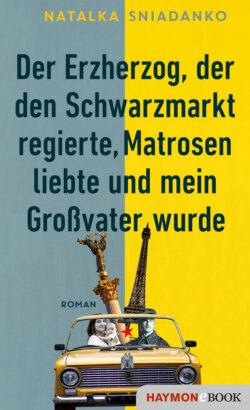Читать книгу Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde - Natalka Sniadanko - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1970–1980
ОглавлениеHalyna sollte eine Schule mit dem Schwerpunkt Deutsch besuchen. Großmutter Sofia bot an, Halyna könne bei Großvater Wilhelm und ihr wohnen, denn von ihnen sei es nicht weit zur Schule. Nun sah Halyna ihre Mutter und Babuschka Aljona nur mehr am Wochenende.
Großmutter Sofia hatte wenig Ähnlichkeit mit den anderen Großmüttern, die Halyna sah. Die Großmütter in den benachbarten Wohnungen waren dick, träge und trugen stets karierte Kittelschürzen aus Nylon oder unförmige Kleider, die aussahen wie Kittelschürzen. Diese Großmütter trugen im Winter bodenlange graue Mäntel und im Frühling und Herbst ebenso graue Regencapes. Sie trugen ausgetretene, flache Schlappen und mit alten Tüchern ausgestopfte Barette. Die Nachbarsgroßmütter rochen nach billigem sowjetischem Parfum, färbten ihr Haar mit Tinte bläulich und steckten es zu oberlehrerinnenhaften Knoten hoch, aus denen auf allen Seiten igelhaft lange schwarze Haarnadeln ragten. Sie waren geschlechtslose Geschöpfe, eine Art graue Engel, jederzeit dazu bereit, Pampuschky oder Pfannkuchen zuzubereiten und ihren Enkeln etwas Leckeres zu kaufen.
Großmutter Sofia hingegen erlaubte sich ihr Äußeres betreffend keine Nachlässigkeiten. Wie durch ein Wunder kam sie in der Sowjetzeit an echte französische Parfums und Kosmetika. Sie färbte ihr immer noch dichtes Haar in ihrer ursprünglichen Farbe nach und trug es zu einem stilvollen Pagenkopf geschnitten, sie zog sich die Augenbrauen in einer exakten Linie nach, verwendete nur qualitativ hochwertige Kosmetikprodukte, machte sich mehrmals pro Woche eine Gesichtsmaske, ging regelmäßig zur kosmetischen und zur Heilmassage, kümmerte sich immer um Maniküre und Pediküre, machte regelmäßig Gymnastikübungen für Rücken und Taille, hatte nie überschüssige Kilos und ging im Sommer fast jeden Morgen in den Kaiserwald joggen. Sie trug selbstgenähte, mit großen grünen Blumen bestickte Kostüme oder Kleider und stilvolle Seidenschals, die eine befreundete Künstlerin in speziellen Farben für sie bemalte. Mit dieser Künstlerin traf sie sich fast jeden Sonntag in der Stadt: Sie spazierten durch den Park, tranken in einer Konditorei Kaffee und gingen später zu Großmutter Sofia nach Hause, wo sie bei ein paar Gläschen Rotwein Préférence spielten. Diese Tradition stammte aus der Vorkriegszeit, als in Großmutter Sofias Haus jeden Sonntag Préférence gespielt wurde. Und obwohl Halynas Mutter Kartenspiele hasste, traute sie sich nicht, mit dieser Tradition zu brechen.
Großmutter Sofia trug zu Hause nie Kittelschürzen, sie besaß nicht einmal eine, nur einen Morgenrock aus Seide, in dem sie morgens und abends vom Schlafzimmer ins Badezimmer ging und morgens danach in der Küche ihren Kaffee trank. Tagsüber trug sie immer helle, kaffeefarbene Kleider mit Spitzenkragen. Von diesen Kleidern hatte die Großmutter ein paar Dutzend, die alle sehr ähnlich waren: gemütlich, aber zugleich elegant und erlesen. Halyna verstand nicht, wie es der Großmutter selbst beim Kochen gelang, ihre Kleider frei von Flecken zu halten. Jede von Sofias Bewegungen war so bedacht und geschickt, dass sie kaum jemals etwas verschüttete, zerschlug und Kleidung oder Boden niemals beschmutzte. Selbst die Tischdecke des Tischs, auf dem sie kochte, blieb schneeweiß. Die Großmutter vergaß nie, sie rechtzeitig wegzuräumen oder etwas darüberzubreiten.
Nur Halyna durfte sie Großmutter nennen, für alle anderen war sie Pani Sofia. Solange Halyna sich erinnern konnte, hatte ihre Großmutter Verehrer gehabt. Selbst als Großvater Wilhelm noch am Leben war. Er hatte nichts dagegen, dass die Großmutter hin und wieder mit einem ihrer Kunden, der sich für einen besonders eleganten Anzug erkenntlich zeigen und sich an einem Gespräch mit einer intelligenten Dame erfreuen wollte, im Stadtzentrum zu Abend aß. Großmutter Sofia war eine legendäre Lemberger Schneiderin, bei ihr nähen zu lassen konnte sich längst nicht jeder leisten. Als Großmutter immer weniger Bestellungen entgegennahm, erfreuten sich die von ihr genähten Kleidungsstücke größerer Berühmtheit als die der teuersten Marken.
Bei Großmutter Sofia hatte alles ein System. Auf ihrem Arbeitstisch lag ein dickes Notizbuch mit Ledereinband, in dem sie minutiös ihr Arbeitspensum notierte. Nicht nur was ihre Kunden und die Fertigstellung der Bestellungen betraf, sondern auch, was sie zu kochen oder einzukaufen plante. Großmutter Sofia vergaß nichts, und Halyna wusste genau: Was man der Großmutter versprach, musste man halten. Denn die Großmutter notierte jedes Versprechen in ihrem Buch und würde die Ausführung später überprüfen. Nicht, weil sie Halyna nicht vertraute, sondern weil sie schlichtweg alles überprüfte.
Halyna sah Großmutter Sofia sehr ähnlich. Sie war zart gebaut, hatte dichtes schwarzes Haar, feine Gesichtszüge und große braune Augen mit markanten Augenbrauen, war groß und schlank, mit schmaler Taille und vollen Brüsten. Halyna hatte auch Großmutters Geschick geerbt, sich elegant zu kleiden und auf ihr Äußeres zu achten.
„Sie haben gute Gene“, sagte eine Kosmetikerin einmal zu ihr. „Jetzt wissen Sie es noch nicht zu schätzen, aber mit den Jahren wird es sich bemerkbar machen. Sie werden langsamer altern, selbst wenn Sie sich nicht allzu sehr um Ihre Haut kümmern.“
Doch die Angewohnheit der Großmutter, bei der Kosmetikerin regelmäßig Cremen zu bestellen und sich jeden Monat einer Behandlung zu unterziehen, hatte Halyna nicht geerbt. Ihre in der Jugend sehr empfindliche Haut gewöhnte sich erst Mitte dreißig an Make-up. Davor musste sie die gereizte Haut nach jedem Schminken ein paar Tage lang behandeln. Großmutter Sofia hatte einen dunklen Teint, ihre Haut hatte keine Flecken oder Unebenheiten und wirkte auch ohne großen Aufwand stets makellos. Halyna beneidete die Großmutter, denn ihre eigene Haut war sehr hell, fast durchsichtig, und schrecklich empfindlich. Ein unmerklicher Temperaturwechsel oder die Berührung mit einem rauen Handschuh genügten, um auf ihrer Haut eine Rötung hervorzurufen, die einige Tage anhielt. Halyna litt sehr unter diesen roten Flecken und versuchte manchmal, sie mit Tönungscreme abzudecken, doch auch das half nicht, und die Reizung wurde noch stärker. Nur wenn ihr Gesicht sonnengebräunt war, war Halyna zufrieden mit ihrer Haut.
Sofia war Halynas Großmutter väterlicherseits. Babuschka Aljona, ihre Großmutter mütterlicherseits, starb, als Halyna noch klein war. Babuschka Aljona wurde im Osten der Ukraine geboren, weit weg von Lemberg, in der Stadt Slowjansk, in der weder Halyna noch ihre Mutter noch Großmutter Sofia je gewesen waren. Babuschka Aljona kam in den 1940er Jahren nach Lemberg. Dort brachte sie Halynas Mutter zur Welt. In Slowjansk war Babuschka Aljonas Schwester zurückgeblieben.
Aljonas Schwester war von Geburt an blind, lebte in einer speziellen Einrichtung und fertigte Collagen an. Auf Kartonbögen von unterschiedlichem Format klebte sie seltsam geformte Figuren in den verschiedensten Farben, manchmal ausgeschnitten aus linierten oder karierten Schulheften. Die Figuren hatten bunte Konturen, waren innen weiß oder chaotisch übermalt. Da sie die Figuren manchmal schief übereinanderklebte, entstand eine reliefartige Oberfläche. Die Bilder waren einzigartig, man musste sie mit geschlossenen Augen befühlen. Das Abtasten piekste Halyna angenehm in den Fingerkuppen. Danach blickte sie manchmal lange, ohne zu zwinkern, auf das Kunstwerk, und in ihrem Kopf begann sich ein Kaleidoskop zu drehen, in dem Bilder erschienen, die mit den Abbildungen nichts mehr zu tun hatten.
Manchmal wandte sich Babuschka Aljonas Schwester vom Abstrakten ab und schnitt bunte Blumen aus, meist Mohnblumen, die auch gelbe, blaue und sogar gelb-graue Blütenblätter haben konnten. Oft entsprangen die Blumen ihrer blinden Fantasie, denn echte Blumen hatte sie nie gesehen, kannte sie nur aus den Beschreibungen anderer. Die Konturen der Blumen trug sie manchmal mit einer dicken Schicht Gouache auf, die Flächen malte sie später aus oder ließ sie weiß. Sehr selten klebte sie die aus Papier ausgeschnittenen Blumen nicht auf Karton, sondern auf Stoff. Die Zeitschrift Sowjetische Frau berichtete einmal sogar über Aljonas Schwester. Diese Ausgabe der Zeitschrift hob Großmutter Sofia auf. Babuschka Aljona stand ihr ganzes Leben mit ihrer Schwester im Briefwechsel, hin und wieder erhielt sie mit einem Brief ein paar kleine Collagen oder Fotos von großen Arbeiten. Großmutter Aljona rahmte diese Geschenke und hängte sie auf.
In den Briefen teilten die Schwestern einander mit, dass bei ihnen alles gut sei, nur die Gesundheit lasse zu wünschen übrig: Die Beine sind müde, der Rücken schmerzt. Babuschka Aljona hatte geschwollene Beine mit blau hervortretenden Venen, die besonders morgens und abends stark schmerzten. Stöhnend massierte sie ihre Beine und rieb sie mit Kastanienblüten-Tinktur ein, danach ging sie lange im Flur auf und ab. Die Großmutter war füllig und verließ selten das Haus, ihre Tage verbrachte sie am Fenster sitzend oder vor dem Fernseher. Sie liebte es, Pfannkuchen und Wareniky zu machen, und füllte sie mit den unterschiedlichsten Dingen. Diese Gerichte bereitete sie fast täglich und vortrefflich zu.
„Bei uns macht man nicht so kleine Wareniky wie hier. Sondern ordentliche, große. Und man sagt: Nimm drei, essen vorbei!“, erzählte Babuschka Aljona, machte die Wareniky aber klein und „okkurat“, wie sie es nannte, aus ganz dünnem Teig. Dabei versuchte sie Großmutter Sofia zu übertreffen, indem sie den Teig noch durchsichtiger und die Täschchen noch winziger machte.
Darin bestand ihr spezielles weibliches Rating: in der Zubereitung der filigransten Wareniky. Ihre Herangehensweisen waren sehr unterschiedlich. Babuschka Aljona bereitete den Teig nach einem geheimen, nur ihr bekannten Rezept zu, das selbst mit detaillierter Anleitung niemandem so gelang wie ihr. Halyna wusste nur, dass die Großmutter geschmolzene Butter, ein Eigelb und heiße Milch in den Teig gab. Danach knetete sie ihn lange auf einem speziellen Brett. Die Wareniky selbst formte Babuschka Aljona folgendermaßen: Sie schnitt lange Streifen vom Teig ab, rollte diese auf dem Brett aus und teilte sie flink in einheitliche, weiche Vierecke. Diese legte sie in geraden Reihen auf, nahm eins nach dem anderen, drückte die Füllung hinein und dann die Kanten aufeinander. Die Großmutter knetete den Teig immer im Stehen, nur wenn sie besonders viele Wareniki zu machen hatte, arbeitete sie im Sitzen.
Großmutter Sofia sagte zu den Wareniky „Piroggen“. Sie knetete den Teig immer im Sitzen in einem speziellen länglichen Holztrog, der ein bisschen wie eine Babybadewanne aussah. Sie hatte kein Spezialrezept, nahm Wasser, ein Ei und Mehl („soviel es braucht“), knetete den Teig und zupfte fein säuberlich ein Kügelchen nach dem anderen für die Wareniky davon ab. Die fertigen Wareniky legte sie auf ein Brett. Großmutter Sofia füllte ihre Piroggen immer mit Kartoffeln und Quark, Babuschka Aljona ihre Wareniky hingegen mit allem Möglichen: mit Kraut, Fleisch, Sauerkirschen, Kirschen, verschiedenen Beeren, ja sogar mit Stachelbeeren. Füllte sie die Wareniky mit Kartoffeln, gab sie fast keinen Quark dazu, dafür häufig angeröstete Zwiebel.
Nicht weniger kompliziert und nuancenreich war der Vorgang des Kochens der Piroggen. Der Topf fasste eine bestimmte Anzahl und exakt so viele musste man ins kochende Wasser legen. Die Kochzeit betrug wenige Minuten, dabei sollte der Teig weder roh bleiben noch zerkochen. Die Wareniky oder Piroggen mussten besonders sorgfältig und gekonnt geformt werden, dabei war es kategorisch verboten, die Teigränder mit Mehl zusammenzudrücken, damit sich diese im Wasser nicht lösten. Um die luftige Konsistenz des Teigs zu erhalten, sollte so wenig Mehl wie möglich verwendet werden. Großmutter Sofia verwendete grundsätzlich nur das ukrainische Wort für Mehl, Babuschka Aljona das russische.
Beide Großmütter brachten Halyna seit früher Kindheit bei, Wareniky beziehungsweise Piroggen zuzubereiten, und weihten sie auch in die Feinheiten anderer Teigrezepte ein: Hefeteig, Blätterteig, Biskuitteig. Mit der Zeit wusste sie, wann ein Teig fest genug war, hatte ein ebenso gutes Auge wie ihre Großmütter für die benötigte Menge an Mehl beziehungsweise dafür, ob man dem Pfannkuchenteig noch ein bisschen Milch oder Wasser beigeben musste, damit er nicht zu dickflüssig war.
Der Teig sprach nicht nur durch sein Aussehen zu Halyna, sondern auch durch Konsistenz, das Vorhandensein von Bläschen und die spezifische Hefeteig-Struktur. Auch der Geruch war wichtig. Roch der rohe Teig nicht gut, würde er auch gebacken nicht gut schmecken und riechen, hatte sich Halyna eingeprägt. Das Arbeiten mit Teig schulte – wie sie später verstehen sollte – nicht nur ihre Feinmotorik und die taktile Wahrnehmung, sondern lehrte sie auch Geduld, eine der wichtigsten Tugenden im Leben. Es brachte ihr bei, ruhig zu warten, wenn es notwendig war, und ebenso schnell und entschlossen zu handeln, wenn der Teig aufgegangen war und sofort in den Ofen musste. Waren ein Kuchen oder die Wareniky fertig, musste man ebenso entschlossen handeln, um das Resultat nicht zu verderben.
Die kulinarische Schulung durch die beiden Großmütter lehrte Halyna auch nützliche logistische Fertigkeiten: gleichzeitig ein paar Aufgaben im Kopf zu behalten (salzen, pfeffern, nicht vergessen, das Gas nach zehn Minuten abzudrehen), die Abfolge von Handlungen richtig zu planen (zuerst das Fleisch für den Borschtsch schneiden, dann ins kochende Wasser werfen, erst danach das Gemüse putzen und schneiden; auch das Gemüse hat seine Reihenfolge: zuerst die rote Bete, denn sie muss am längsten kochen, dann Karotten und Kartoffeln, am Ende Zwiebel anbraten und Tomaten dazu. Im Sommer kann man dann noch frische Kräuter und ein paar Sauerkirschen oder eine Handvoll rote Johannisbeeren für das Aroma in den Borschtsch geben). Genauso sollte Halyna später ihren Tag planen, wenn sie in kurzer Zeit viele Dinge zu erledigen hatte: am Vormittag das Wichtigste, am Nachmittag alles, was warten konnte. Oder am Vormittag, wenn der Kopf noch träge war, Erledigungen, die mit physischer Anstrengung verbunden waren (Waschen, Aufräumen, Einkaufen, Behördengänge), und am Nachmittag, wenn sie endlich ganz wach war, Arbeiten, bei denen sie ihren Kopf brauchte (dann malte sie für gewöhnlich).
Im Wissen um den Nutzen dieses Trainings gewöhnte Halyna ihren Sohn von klein auf an die Arbeit in der Küche. Oles wusste lange nicht, dass seine Eltern eine Putzfrau beschäftigten. Als Kind hatte er, ebenso wie Halyna früher, genau abgesteckte Aufgabenbereiche im Haushalt, etwa musste er die Kleidung ordentlich in den Schrank legen, um sich am Morgen schnell für Kindergarten oder Schule fertig zu machen und ebenso schnell seine Sachen für einen Wochenendausflug einpacken zu können.
Großmutter Sofias Piroggen und Babuschka Aljonas Wareniky schmeckten tatsächlich verschieden, doch war es kein qualitativer Unterschied, sondern eine Erweiterung der Geschmackspalette. Das Bestreben der beiden Hausfrauen, einander zu übertreffen, gipfelte in einem nicht enden wollenden Drang nach Vollendung bei jeder der beiden.
Beim Formen der Wareniky sang Großmutter Sofia oft Koledas – polnische Weihnachtslieder –, ein Kinderlied über zwei Kätzchen und endlose Lemken-Lieder, zu denen Halyna sich zusammenrollen und sanft einschlafen wollte, wie in ihrer Kindheit, als die Großmutter sie tatsächlich mit diesen Liedern in den Schlaf gewiegt hatte. Babuschka Aljona konnte nicht singen und kannte keine Lieder. Wenn sie also abends auf ihre Enkelin aufpasste, erzählte sie ihr beim Einschlafen Gedichte, die sie in ihrer sowjetischen Kindheit gelernt hatte. In Halynas fantastischen Kinderträumen streichelten Lemken in Filzhüten über die Köpfe von kleinen Kätzchen, die sich in Lenin und den Ofensetzer3 verwandelten, die aus irgendeinem Grund ein wenig wie ein zweiköpfiger Drache aussahen oder wie Kotyhoroschko mit seiner Keule.
Im Sommer war Großmutter Sofia im kulinarischen Wettstreit mit Großmutter Aljona immer im Vorteil. Sie besaß ein Haus in einem gottvergessenen Dorf in den Karpaten. In diesem Haus gab es einen echten Holzofen. Getrocknete Pilze und Beeren, Minze und Thymian für Tee, viele Heilkräuter, Krauttaschen und Fladen mit Mohn. Das konnte Babuschka Aljona nicht überbieten. Höchstens mit Wareniky mit Sauerkirschen und Mohn. Die machte Großmutter Sofia nie und gab zu, dass ihre Zubereitung tatsächlich eine sehr hohe Kunst sei.
Großmutter Sofias Krauttaschen – mit Sauerkraut gefüllte Piroggen aus Hefeteig – wurden über Dampf gewärmt und mit Grieben serviert. In Halynas Vorstellung gab es nichts Besseres. Außer im Ofen überbackene Krauttaschen vielleicht. Oder im Ofen gebackene Fladen aus Sauermilch und Mehl, mit frischer, heißer Milch, Honig und geriebenem Mohn übergossen. Nach dem Sommer brachten sie immer einen Vorrat an Krauttaschen und Fladen aus den Karpaten mit nach Hause, die sie ein paar Wochen lang mit nostalgischen Gefühlen aßen.
In ihren Briefen versprach Babuschka Aljona der Schwester oft: „Bald, ganz bald komme ich dich besuchen, und ich nehme meine Enkelin Halyna mit, damit du sie endlich kennenlernst.“ Aus Slowjansk, oder „Slawjansk“, wie Babuschka Aljona mit der Betonung auf „a“ sagte, kamen als Antwort enthusiastische Einladungen, welche die blinde Schwester irgendjemandem diktierte, und ihre Beteuerung: „Die Landschaft ist sehr schön. Es gibt Beeren und Pilze und in der Ferne sieht man angeblich die Halden vom Salzabbau.“ In ihren letzten Lebensjahren sah Babuschka Aljona schlecht und bat Halyna, ihr die Briefe der Schwester vorzulesen. Danach diktierte sie ihr die Antwort. Halyna überlegte hin und her, ob man „plötzlich“ schrieb oder „plözzlich“, wie es die Großmutter aussprach, und „jetzt“ oder „jezz“ und ob man „fastziniert“ zusammen oder auseinander schrieb.
Der letzte Brief aus Slowjansk kam kurz vor Babuschka Aljonas Tod. In diesem Brief versprach die Schwester, sehr bald wieder zu schreiben, doch sie tat es nicht. Einige Jahre später kam aus dem Wohnheim eine Mappe mit ihren letzten Arbeiten. Dort saß ein fröhliches Mädchen aus applizierter hautfarbener Seide in verschiedenen Posen inmitten von seltsamen Mohnblumen, die mal durchsichtig und mal mit stark verwässerter Aquarellfarbe ausgemalt waren, sodass das karierte Papier durchschien. In dem Mädchen erkannte man auf den ersten Blick Halyna. Für Halyna hatten die Arbeiten von Großmutters blinder Schwester, die sie nie gesehen hatte, etwas Furchteinflößendes.
Dieses Gefühl würde Halyna viele Jahre später, wenn sie täglich Nachrichten über die Kampfhandlungen in Slowjansk lesen sollte, erneut heimsuchen. Wie in die Ungewissheit abgefeuerte Kugeln würden dann die Phrasen aus der Kindheit in ihrem Kopf auftauchen: „Es gibt Beeren, Pilze, in der Ferne sieht man angeblich die Halden vom Salzabbau …“
Babuschka Aljona arbeitete als Kartenverkäuferin im Kino Mir, das sich in der damaligen 700-Jahre-Lemberg-Straße befand, die Großmutter Sofia standhaft Poltwjana-Straße nannte. Dieses Kino besuchte Halyna oft mit ihren Freundinnen. Die Mädchen kauften Eis und schauten sich einige Male hintereinander endlose indische Seifenopern an.
In der Sowjetunion liefen die Filme sehr lange in den Kinos, und die Mädchen hatten bald keine Lust mehr, immer wieder dasselbe zu sehen. Also unternahmen sie ihre ersten selbstständigen Ausfahrten in andere Bezirke: ins Kino Sirka oder sogar ins Orljatko in der scheinbar unerreichbaren Artem-Straße. Die Freundinnen machten in der Nähe jedes Kinos einen Laden ausfindig, in dem sie dickflüssigen Tomatensaft tranken. Den Saft salzten sie, indem sie mit einem Löffel, den man in trübem Wasser abspülen konnte, fest gewordenes Salz aus einem Glas nahmen und umrührten. Oder sie bestellten einen Milchshake, der vor ihren Augen zubereitet wurde, aus Plombir-Eis und Milch mit einem Schuss Heidelbeer- oder Erdbeersirup. Halyna beobachtete gerne den kleinen Springbrunnen, in dem die Verkäuferin die Gläser wusch, und sie mochte den groben Aluminiumhaken des Mixers, in den ein hohes Glas gestellt und dann der laute Motor eingeschaltet wurde. Die Bläschen des Shakes legten sich wie ein öliger Belag auf die Zunge. Und trank man den Shake gleich nach dem Tomatensaft, brauchte man kein Mittagessen mehr, und die zähflüssigen Getränke blubberten und vermengten sich noch den ganzen Film lang im Magen.
Das Verhältnis von Babuschka Aljona und Großmutter Sofia war nicht von Anfang an freundschaftlich. Kurz nach der Hochzeit ihrer Kinder, Alina und Taras, gab es einige Spannungen zwischen den beiden Frauen. Wie der Großteil der russischsprachigen Umsiedler in Lemberg hielt Babuschka Aljona die ansässige Bevölkerung insgeheim für Landeier, obwohl sie wusste, dass Großmutter Sofia nie auf dem Land gelebt hatte. Und obwohl Großmutter Sofia es zu verbergen versuchte, hatte sie – wie alle Galizier – den Russischsprachigen gegenüber eine leicht herablassende Haltung und mochte sie nicht, weil sie so laut und anders waren.
Einst hatte in der Straße, die Großmutter Sofia eisern Sigmundstraße nannte, ein ganzes Haus der Familie gehört, doch später blieb ihnen nur eine Wohnung im obersten Stockwerk. Den Rest hatten sich sowjetische Offiziere angeeignet. Diese Erinnerung half Großmutter Sofia nicht dabei, ihre Abneigung gegen alles Russischsprachige zu überwinden, obwohl sie natürlich wusste, dass Babuschka Aljona nichts mit den „Befreiern“ zu tun hatte. Aljona wurde als Kind von ihren Eltern nach Poltawa zu einer Verwandten geschickt, um sie vor dem Hunger zu bewahren. Selbst starben sie den Hungertod, und die Verwandte übersiedelte mit der späteren Babuschka Aljona nach Lemberg. Die Verwandte hatte keine Familie und zog das Mädchen wie ihre eigene Tochter groß. Babuschka Aljona heiratete einen Tischler, der ein geschicktes Händchen und massenhaft Bestellungen hatte. Er arbeitete in einer staatlichen Tischlerei und pfuschte abends. Auf erledigte Aufträge wurde häufig angestoßen, und so wurde er schließlich zum Alkoholiker. Als ihre Tochter Alina mit neunzehn Jahren heiratete und ein halbes Jahr später Halyna zur Welt brachte, lebte der Großvater nicht mehr.
Babuschka Aljona war das absolute Gegenteil von Großmutter Sofia. Mittlerer Wuchs, rund, ausdrucksstarke Gesichtszüge, üppiger Vorbau und Po, markante Backenknochen und ein hoher Dutt auf dem Kopf. Sie sprach laut, viel und emotional, hatte einen Hang zum Theatralischen und zu lautstarken hysterischen Anfällen aus jedem Anlass, aber auch ohne. Nach jedem Satz setzte sie scheinbar ein Ausrufezeichen. Sie hatte die Angewohnheit, ganz nah an ihren Gesprächspartner heranzugehen und wild zu gestikulieren. Trat jemand einen Schritt zurück, fasste sie das nie als Wunsch nach mehr Distanz auf, sondern machte einen weiteren Schritt auf den Gesprächspartner zu, als hätte sie Angst, er könnte sie nicht hören oder davonlaufen. Kaum jemand ertrug eine längere Unterhaltung mit Babuschka Aljona, ihre übermäßige Expressivität machte müde und man wollte tatsächlich nichts wie weg. Vielleicht hatte sie deshalb wenige Freundinnen. Als sie in Rente ging, war Halyna gerade zur Welt gekommen, und Babuschka Aljona bestand darauf, dass das junge Paar bei ihr einzog. In den folgenden Jahren rief sie ihre ehemaligen Arbeitskolleginnen fast täglich an und beschwerte sich mit beleidigter Stimme bei ihnen, dass alle sie vergessen hätten und sie niemanden zum Reden habe. Manchmal bekam sie von den ehemaligen Arbeitskolleginnen Besuch, und das war ein echter Festtag für sie. Die Zusammenstellung des Menüs dauerte ein paar Tage, danach verließ sie die Küche volle zwei Tage nicht. Bevor die Gäste kamen, zog sie ihre schönste Kittelschürze an und stemmte zufrieden die Hände in die Seiten.
„Was bin ich müde!“, sagte sie dann, während sie vor dem Spiegel ihren Dutt zurechtzupfte.
In der Rente wurde die Kittelschürze zu Babuschka Aljonas wichtigstem Kleidungsstück. Sie hatte einige Alltags-Kittelschürzen, die meisten aus warmem Baumwollstoff mit buntem Blumendruck und einige aus leichter Baumwolle mit kurzen Ärmeln; und sie hatte Festtags-Kittelschürzen, die sich nur dadurch von den anderen unterschieden, dass sie seltener getragen wurden. Die Kleider, in denen Großmutter Aljona früher zur Arbeit gegangen war, verstaubten im Schrank, der Großteil hätte ihr nach einem Jahr Rentnerinnenleben aber ohnehin nicht mehr gepasst.
Nach jedem Besuch von Babuschka Aljonas ehemaligen Arbeitskolleginnen aß die Familie noch eine Woche lang die übriggebliebenen Speisen. Am häufigsten bekam die Großmutter von Tamara Lwowna, einer Kindergärtnerin, Besuch. Im Gegensatz zu den früheren Arbeitskolleginnen, die auf eine Stunde vorbeikamen und kaum etwas aßen, liebte Tamara Lwowna – wie Babuschka Aljona auch – üppige Festessen. Sie schlossen die Küchentür hinter sich und unterhielten sich lange. Zu Beginn bemühten sie sich zu flüstern, doch keine der beiden beherrschte es, leise zu sprechen, deshalb wurden ihre Stimmen schon bei der ersten Flasche selbstgemachten Apfelweins lauter und die achtjährige Halyna hörte, wie sie sich über ihre undankbaren Kinder, Enkel und besonders die Schwiegersöhne beklagten. Babuschka Aljona beschwerte sich auch über Großmutter Sofia, die sie überheblich fand. Sie dachte, Sofia würde den Schwiegersohn gegen sie aufbringen.
„So klein und dürr, und so böse Augen“, beschrieb Babuschka Aljona sie. „Ich will ja nichts sagen, sie ist ein guter Mensch. Hat mir sogar ein Kleid genäht. Aber irgendwie geht mir nicht ein, dass so eine dünne Person nicht böse ist.“
Bei allen, die den Hunger erlebt hatten, war das Essen zum Kult geworden, und für Babuschka Aljona war es die einzige Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken. Sie kochte für alle, die sie liebte, die ihr leidtaten, die sie achtete, und sogar für jene, die sie nicht so sehr mochte. Für die, die sie liebte, kochte sie mit besonderer Hingabe.
Ungefähr nach der dritten Flasche hausgemachten Weins oder nach der ersten Flasche Wodka, den Tamara Lwowna mitgebracht hatte, kam Taras nach Hause, Babuschka Aljonas Schwiegersohn und Halynas Vater. Er mochte Tamara Lwowna nicht und war der Ansicht, dass sie einen schlechten Einfluss auf Babuschka Aljona habe.
„Diese Galizier“, beschwerte sich die Großmutter bei Tamara Lwowna. „Die sind überhaupt nicht gastfreundlich. Geizig und stolz sind sie. Sagen nichts, brauchen niemanden.“
Später verstand Halyna, dass Babuschka Aljonas übermäßige Expressivität und ihr hartnäckiges Bestreben, sich in das Eheleben ihrer Tochter einzumischen, zu den ersten Rissen in der Beziehung des jungen Ehepaars geführt hatten. Es war Babuschka Aljona, die aus geheimen Quellen erfuhr, dass Taras eine Geliebte hatte. Sie rief sofort Großmutter Sofia zu sich, um sich mit ihr zu beraten. Großmutter Sofia kam, schick wie immer, in einem schwarzen Rock und schwarzen Schuhen, einem Blazer über der weißen Bluse, außerdem trug sie eine Perlenkette und goldene Perlenohrringe.
„Bei den Jungen darf man sich nicht einmischen“, sagte Großmutter Sofia. „Sagen Sie niemandem etwas, vielleicht wird alles gut. Wenn Sie sich einmischen, wird nichts mehr zu retten sein.“
Doch Babuschka Aljona verdrehte theatralisch die Augen, fasste sich an die Brust, nahm einen Schluck hausgemachten Weins und begann ihr Lamento:
„Ich wusste, dass sie mit diesem Westler nicht glücklich wird. Mein armes Mädchen! Wie sollen wir jetzt weiterleben!“
So ging es, bis Taras und Alina am Abend nach Hause kamen. Die zu diesem Zeitpunkt bereits ziemlich angetrunkene Babuschka Aljona stürzte sich mit Fäusten auf ihren Schwiegersohn. Taras und Großmutter Sofia verließen gemeinsam das Haus. Von da an waren Halynas Erinnerungen an ihren Vater nur mehr episodenhaft: Er schenkte ihr eine teure Puppe, er ging mit ihr einkaufen, ins Kino, in den Vergnügungspark. Sie aß Eis, er schaute ihr schweigend dabei zu.