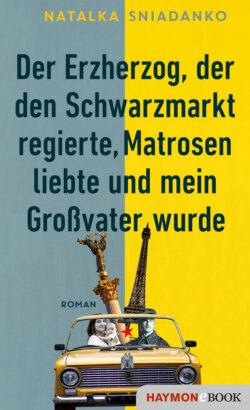Читать книгу Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde - Natalka Sniadanko - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1915–1939
ОглавлениеIm ersten Stock von Stepan Lewynskyjs Haus befand sich neben der Küche ein Durchgangszimmer, von dem eine Tür ins Badezimmer führte. Diese weiße Tür verschmolz so gut mit der weißen Tapete, dass sie leicht zu übersehen war. In dem Zimmer beim Fenster stand ein Ledersofa, auf das Sofia als Kind gerne stieg, was natürlich streng verboten war. Doch nur so konnte sie aus dem Fenster schauen. In dem Zimmer gab es noch eine Tür. Sie führte in die Speisekammer, wo Sofia manchmal heimlich mit den Marmeladegläsern hantierte oder vorsichtig Stückchen von einem bereits angeschnittenen Kuchen stibitzte, der hier für den nächsten Tag aufbewahrt wurde.
Die Decke von Sofias Zimmer schmückte Gipsstuckatur in der Form von Ahornblättern. Abends betrachtete Sofia die Blätter, bis ihr die Augen zufielen. Im Herbst sammelte sie gelbe Ahornblätter und Ahornsamen, die man fliegen lassen konnte. Sie trocknete alles und klebte es in ihren Malblock, nach ein paar Jahren füllten ihre Blöcke ein ganzes Bücherregal. Stundenlang konnte sie die Farbschattierungen der Blätter betrachten und die launenhaften Muster der Blattadern. Manchmal bastelte sie Kleider aus Ahornblättern für ihre Puppen, sie schienen ihr das perfekte Material zu sein, das man auch ohne Schnitt verarbeiten konnte.
Sofia mochte Botanik nicht sehr, besonders verabscheute sie die Spaziergänge mit ihrem Lehrer zum Hohen Schloss, bei denen sie sich die Namen verschiedener Pflanzen nach dem polnischen Bestimmungsbuch von Rostafiński einprägen und Fragen beantworten musste – wie sich Bedecktsamer von Nacktsamern und Kreuzblütler von Korbblütlern unterschieden und wie sie alle auf Latein und Ukrainisch hießen.
„Diesen Lehrer hatte ich in Botanik, Astronomie und Geografie“, erzählte Großmutter Sofia. „Er legte nicht nur auf Pflanzensammlungen großen Wert, sondern auch auf Käfer- und Schmetterlingssammlungen, die ich selbst anlegen sollte. Um ein paar Kreuzer das Stück verkaufte er mir kleine Eichenböcke. Im Frühling sollte ich in Pfützen nach Kolbenwasserkäfern und Gelbrandkäfern fischen. Und abends die Sterne beobachten, ihre Namen benennen und auf die Minute genau Sonnenauf- und Sonnenuntergang notieren. Ausländische Briefmarken hat er gesammelt, alte Münzen und Ansichtskarten, wie mein Vater.“
Zu jener Zeit wurde Sofia noch zu Hause unterrichtet, später besuchte sie das Gymnasium. Sie hatte verschiedene Lehrer: In Deutsch und Literatur sowie Latein und Mathematik unterrichtete sie ein alter Deutscher, eine junge polnische Studentin lernte mit ihr fürs Abitur. Auch ein alter ukrainischer Professor aus der „Ridna Schkola“ kam zu Sofia. Diese Schule war eine der wenigen ukrainischen Schulen in Lemberg und wurde ausschließlich mit Spenden finanziert. Auch Sofias Eltern unterstützten die Ridna Schkola, ihre Mutter leitete dort ehrenamtlich sogar den Nähzirkel. Die eigene Tochter jedoch schickte sie ins Mädchengymnasium zur Heiligen Anna, wo die Mädchen neben den üblichen Fächern Unterricht im Waschen und Bügeln erhielten. Und obwohl in den Familien, deren Kinder dieses Gymnasium besuchten, natürlich nicht die Dame des Hauses bügelte, sondern ihre Bediensteten, galten diese Gegenstände für die Bildung der Frau als unverzichtbar.
Sofia hatte eine Freundin, die Osypa hieß und im Nachbarhaus wohnte. Die beiden Mädchen gingen in dieselbe Klasse. Manchmal liefen sie während der Pause in den Kościuszko-Park und setzten sich auf eine Bank, ganz normal und nicht so verführerisch, wie sie es sich in den Frauenzeitschriften abgeschaut hatten. Denn in der Nähe spielten gleichaltrige Jungen Räuber und Gendarm und sprangen dabei über die Rückenlehnen der Parkbänke. In diesem Alter reagierten Jungen noch nicht auf verführerische Posen, deshalb beschlossen Sofia und Osypa, die Aufmerksamkeit ihrer Altersgenossen mit einem für sie interessanten Gesprächsthema zu erregen. Und so erzählte Sofia Osypa vom Zauberkünstler in der Mikolasch-Passage, der filmreif weiße Kaninchen, Ikonen oder Pralinen aus seinem Zylinder zog. Osypa berichtete von einem anderen Zauberkünstler aus dem Sommertheater, der zuerst ein hinter einem Papierparavent stehendes Mädchen anzündete, dann mit einer Pistole ein paar Mal in die Luft schoss – und siehe da, das Mädchen trat wieder vor das Publikum. Dann erzählte erneut Sofia, von einem mutigen Luftfahrer, der mit einem gasgefüllten Ballon hoch, ganz hoch in die Luft stieg und unter dem Applaus des Publikums langsam wieder herabschwebte. Osypa schilderte Sofia ihren letzten Besuch des Kaiserpanoramas in der Hausmann-Passage. Und Sofia erzählte, dass sie im Urania-Kino in der Mikolasch-Passage gewesen sei. Doch vergeblich. Die Jungen spielten weiter, als wären die Mädchen Luft.
„Weißt du noch, wie wir uns im Marysenko-Kino in der Jagiellonen-Straße den ersten Tonfilm angeschaut haben? Die Mumie war das“, sagte Sofia und verlor langsam die Hoffnung.
„Ja, dort ist so eine unheimliche Einfahrt, ganz feucht und muffelig, und drinnen ist es ewig kalt“, erwiderte Osypa.
„Und in den Vorstellungen sind immer Frauen mit kleinen Kindern, die rascheln ohne Ende mit Schokoladenpapier und lassen es dann einfach fallen, bis der ganze Boden mit bunten Verpackungen bedeckt ist, während über die Leinwand die Werbungen von ‚Suchard‘, ‚Milka‘ und ‚Velma Bitra‘ flimmern. Bei Stummfilmen war den Kindern langweilig, sie weinten oder krochen zwischen den Sesseln herum und zwickten alle in die Beine. Bei der Mumie haben die Erwachsenen aber aus Angst geschrien.“
„Stimmt, mir ist bei dem Film fast das Herz in die Hose gerutscht. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, in der der Junge seine Hand auf die Schulter des Ägyptologen legt? Da erwacht die Mumie zum Leben, und aus dem Sarg schaut eine schreckliche Klaue. Sie macht ein quietschendes Geräusch und im selben Augenblick zwickt mich so ein Dreikäsehoch ins Bein!“
Die Mädchen lachten, aber die Jungen beachteten sie noch immer nicht. Da hatte Osypa eine geniale Idee. Sie beobachtete, wie die Jungen ganz in der Nähe ihrer Bank Fußball spielten und dabei schonungslos ihre modischen Schuhe ruinierten. Plötzlich richtete sie sich auf und sagte laut zu Sofia:
„Weißt du, dass der polnische Klub Pogoń gegen die jüdische Hasmonea unentschieden gespielt hat und später auch gegen Czarni Lwów?“
„Gibt’s ja nicht“, wunderte sich Sofia aufgesetzt. „Nein, davon habe ich nicht gehört. Dafür geht mir das letzte Spiel in Drohobytsch nicht aus dem Kopf, der dortige Junak, in dem nur Polen spielen, hat gegen die Lemberger Ukrajina gespielt.“
„Warst du dort?“, fragte Osypa erstaunt.
„Ja, mein Vater hat mich mitgenommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es dort ausgesehen hat“, Sofia lehnte sich auf der Bank zurück und legte lässig ein Bein über das andere.
Nach und nach versammelten sich die Jungen um ihre Bank. Zuerst nur jene, die gerade nicht mitspielten und die anderen nur anfeuerten. Doch mit der Zeit gesellten sich auch die Spieler dazu, denn ohne Zuschauer zu spielen war langweilig.
„Also“, fuhr Sofia fort. „So viele Leute aus der Umgebung wollten sich das Spiel anschauen, dass es unmöglich war, an diesem Tag nach Drohobytsch zu kommen, weder mit dem Zug noch zu Pferd. Wer sich nicht rechtzeitig um die Anreise gekümmert hat, kam zu Fuß, manche marschierten zwei Tage lang! Der Rummel um das Match war sagenhaft. Vor dem Postamt in Drohobytsch warteten über zweitausend Menschen auf die Verlautbarung des Spielergebnisses.“
„Zweitausend?“, fragte jemand ungläubig.
„Vielleicht auch mehr“, antwortete Sofia. „In Lemberg im Kino Schtuka wurde sogar die Vorstellung unterbrochen, und der Techniker hat die Mitteilung ‚Gleich geht es weiter! Ukrajina hat gerade das 4:3 bekommen!‘, schief auf ein Stück Papier gekritzelt, auf die Leinwand projiziert.“
Alle Kinder lachten. Sofia fuhr fort:
„Eine Gruppe von Bauern aus Nahujewytschi ist nach Drohobytsch gekommen, um die Ukrajina anzufeuern. Sie brachten Prozessionsfahnen und ihren Dorfpfarrer mit, aber nur, weil sie die Regeln nicht kannten und immer auf den Priester schauten, um zu wissen, wie sie sich verhalten sollten. Aber die Brille des Priesters war zerbrochen, und er sah nicht, was sich auf dem Spielfeld tat. Die Bauern schrien also einfach mit allen anderen. Da aber die meisten in Drohobytsch zum polnischen Klub Junak hielten, wurde am lautesten geschrien, wenn die Ukrainer ein Tor bekamen.“
„Jetzt verstehe ich, wieso Junak das Match 5:3 gewonnen hat“, seufzte einer der Jungen.
„Am Abend nach dem Spiel hielt der ukrainische Zug ein Stück außerhalb des Bahnhofs, um den Zug mit den polnischen Schlachtenbummlern passieren zu lassen und ein Aufeinandertreffen zu verhindern“, beendete Sofia ihren eindrucksvollen Bericht. „Beide Züge waren voll mit Betrunkenen. Die polnischen Fans schrien mit heiseren Stimmen, die Ukrainer saßen still und niedergeschlagen da, dafür hatten sie am nächsten Tag nur Kopfweh und die Polen noch dazu Halsweh.“
Die Jungen standen mit offenem Mund um die Bank herum, doch Sofia und Osypa taten so, als bemerkten sie sie nicht, standen auf und schlenderten triumphierend in Richtung Schule davon.
Während der Sommerferien, wenn es zu heiß war, um im Freien zu spielen, durfte Sofia auf den Balkon des elterlichen Schlafzimmers. Dorthin trugen sie Schüsseln mit Wasser, in die Sofia ihre Füße stecken konnte. Sofia genoss das kühle Nass und beobachtete, was sich hinter den Fenstern des Nachbarhauses tat. Im Sommer stellten Sofias Eltern eine riesige Palme, die zusätzlich Schatten spendete, auf den Balkon.
Sofia und Osypa saßen jede auf ihrem Balkon und versuchten einander Papierflieger mit Botschaften zuzuwerfen. Meistens gelang es ihnen nicht, und die Papierflieger landeten im Blumenbeet des Innenhofs, von wo sie am nächsten Morgen der Straßenfeger entfernte, der dabei etwas über die „frechen Fräuleins, die ihren Dreck in die Blumen schmeißen“ murmelte.
Wenn die Mädchen keine Lust mehr hatten, Botschaften hin und her zu werfen, vertieften sie sich in ihre Bücher und naschten dabei verschiedene Leckereien: Sauerkirschen, Kirschen, Maiskörner in kleinen Papiertüten, Bonbons – einfach alles, was sie in die Hände bekamen. Beim Lesen hatten sie einen unterschiedlichen Geschmack. Osypa begeisterte sich für die typische Mädchenliteratur dieser Zeit und versuchte Sofia ständig zu überreden, wenigstens einen der zwölf Bände von Das kleinste Küken zu lesen. Doch Sofia mochte Abenteuerromane „für Jungs“ und verschlang die Bücher von Jules Verne, Winnetou von Karl May, Robinson Crusoe von Defoe, Die Abenteuer des Tom Sawyer von Mark Twain und Mowgli. Nur ein einziges Buch lasen die Mädchen mit derselben Begeisterung, nämlich die von Sofias Mutter stibitzten Geheimnisse des Harems. Sofia verriet sich allerdings sofort, als sie beim Mittagessen unvorsichtigerweise fragte, was eine „Odaliske“4 sei. Die Mutter antwortete, dass es so ein Wort nicht gebe, vielleicht habe Sofia etwas durcheinandergebracht, oder „Obelisk“ sei irrtümlich so geschrieben worden. Am nächsten Tag war das Buch verschwunden, Sofia fand es erst ein paar Wochen später wieder und gab es Osypa zu lesen.
Mit der Zeit verbot die Mutter Sofia das Lesen bestimmter Bücher, weil sie diese für zu frivol für ein junges Mädchen hielt. Ebenso würde Sofia später Halyna bestimmte Bücher verbieten. Das schürte natürlich die kindliche Neugier am Verbotenen. Als Halyna ihren eigenen Sohn großzog, überlegte sie manchmal, ihm das eine oder andere Buch zu verbieten, um bei ihm dasselbe unerträgliche Kribbeln der Neugier und Lust, das verbotene Buch innerhalb weniger Stunden zu verschlingen, bevor man auf frischer Tat ertappt wird, hervorzurufen.
Stepan Lewynskyj versperrte die Schubladen des Schreibtischs in seinem Kabinett. Den Schlüssel trug er stets bei sich. In einer der Schubladen bewahrte er einen kleinen mechanischen Fisch in einer Holzdose auf. Manchmal durfte Sofia auf den winzigen Knopf drücken, der die Dose öffnete, und danach auf einen anderen, der den Fisch in die Höhe springen und mit dem Schwanz schlagen ließ. In derselben Lade verwahrte der Vater ein paar winzige Vögelchen aus Elfenbein und eine Uhr, die kaum größer war als eine Streichholzschachtel und deren Zeiger man sogar verstellen konnte.
In der obersten Schublade bewahrte der Vater Geld auf, daran erinnerte sich Sofia genau. Als sie etwas älter war, nahm er aus dieser Schublade einmal pro Woche ihr Taschengeld. In der Schublade daneben verwahrte der Vater aus Sofias damaliger Perspektive viel größere Schätze: winziges Lardelli-Konfekt, das aus Warschau kam, und ebenso winzige Fruchtgelees. Sofia konnte sich nicht an den Geschmack dieser Süßigkeiten erinnern, sie wusste nur, dass sie immer Mangelware waren und auf der Zunge zerschmolzen, bevor man den Geschmack erkennen konnte. Jedes Mal nahm sie sich vor, die Leckerei beim nächsten Mal länger zu genießen und nicht alles auf einmal hinunterzuschlucken, doch nie hielt sie sich daran.
In einer der Laden wurde auch das uralte Heft mit Rezepten aufbewahrt, das nur zweimal im Jahr hervorgeholt wurde: zu Weihnachten und zu Ostern.