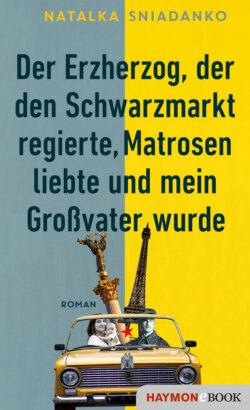Читать книгу Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde - Natalka Sniadanko - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1915–1939
ОглавлениеGroßmutter Sofia wurde in dem Eckhaus geboren, das zu den „Realitäten“ – also zum privaten Eigentum – Stepan Lewynskyjs gehörte, des angesehenen Lemberger Arztes und Amateursängers. Das Haus lag in der Nähe des Parks, den Sofia ihr ganzes Leben lang Jesuiten-Garten nannte, selbst als er längst Kościuszko-Park hieß. Und ihre Straße blieb für die Großmutter stets die Sigmundstraße und wurde nicht zur Gogol-Straße.
Im Jesuiten-Garten gab es einen Brunnen, der Sofia als Kind riesengroß erschien. In der Mitte des Brunnens war ein dünnes Rohr eingemauert, aus dem Wasser sprudelte. Die Kinder hielten das Rohr, das sie „Rurka“ nannten, der Reihe nach mit dem Finger zu, und das Wasser spritzte in alle Richtungen. Dabei brachen sie in Gelächter aus, verloren das Gleichgewicht und fielen ins Wasser. Sofia war vorsichtig und fiel nie in den Brunnen, trotzdem wurde ihre Kleidung jedes Mal nass. Wenn sie nach der Schule einen Abstecher in den Park machte, brachte sie ihren Schulranzen mit den Heften und Büchern, die ihre Mutter altmodisch „Bischki“ nannte, stets pitschnass nach Hause. Nur das Pennal mit den „Koh-i-noor“-Stiften und „Atlas“-Schreibfedern blieb manchmal trocken. Wenn Bronislawa danach die nassen Sachen des Mädchens ausräumte, murmelte sie immer eine ihrer geheimnisvollen und schrecklichen Drohungen:
„Wenn du nicht folgst, musst du später nach Rio de Janeiro auswandern und dort als Wäscherin arbeiten. Die waschen dort in einem Brunnen auf dem schmutzigsten Platz der Stadt, auf dem überall halbverfaulte Hunde- und Katzenkadaver herumliegen.“
Bronislawa war seinerzeit in Rio de Janeiro gewesen und hielt die Stadt für eine der schmutzigsten der Welt. Wenn sie von dieser Reise erzählte, schwang stets Ekel mit:
„Kein Wunder, dass auf unserem Schiff nur acht Passagiere waren. Wer einmal in Brasilien war, fährt kein zweites Mal hin. Hundert Dollar für die Überfahrt auf dem Dampfer, zweieinhalb Monate kein Festland am Horizont, und dann dieser ganze Dreck, Menschenhandel mitten auf der Straße und eine unerträgliche Hitze. Ich habe dort keinen einzigen Rinnstein gesehen. Der Dreck fließt einfach die Straße runter, an manchen Stellen kannst du nur weiter, wenn ein Neger dich hinüberträgt. Ohne Sklaven geht es dort gar nicht. Kein Wunder, dass die Männer ihren Frauen weder Schmuck noch Geld schenken, sondern Neger. Wenn eine Frau Geld braucht, zwingt sie ihre Sklaven, irgendwas herzustellen und zu verkaufen. Nur so kann sie zu Geld kommen. Manchmal brennen die Neger durch und überfallen Reisende. Ich musste mich auch mal gegen einen zur Wehr setzen, zuerst mit meinem Regenschirm, dann mit einem Messer. Wäre mir nicht jemand zu Hilfe gekommen – der Neger hätte mich abgestochen. Die Sklaven bekommen für jedes Vergehen einen Eisenring um den Arm oder Hals. Beim Gehen haben sie damit geklappert, dass es einem ganz bange geworden ist.“
Um das große Blumenbeet vor der Universität, die die Mutter in alter Manier „Sojm“ nannte, kreiste stets ein stattlicher Greis, der „Brezel, immer frische Brezel“ verkaufte. Die Mutter kaufte Sofia eine große Breze um fünf Groschen oder zwei kleine um je zwei Groschen. Nur selten konnte sie der Mutter zwei große Brezen um sechs Groschen abluchsen. Wenn Großmutter Sofia von ihrer Kindheit erzählte, wechselte sie unwillkürlich in die alte Lemberger Mundart. Halyna musste oft die Bedeutung einzelner Worte oder sogar ganzer Sätze nachfragen.
„Am schönsten war’s aber im Frühling“, erzählte die Großmutter, „wenn wir zu dritt – gemeinsam mit dem Vater – im Jesuiten-Garten spazieren gingen und er sagte, dass wir am Abend ins Parkrestaurant essen gehen. Das war eine Freude! Im Restaurant gab es Wiener Schnitzel mit Kartoffeln. Am liebsten mochte ich sie mit jungen Dillkartoffeln und saurer Sahne. Und dazu Gurken-Salat. Einmal saßen wir auf der Terrasse und lauschten der Musikkapelle, Mutter beugte sich zu Vater hinüber und flüsterte ihm ins Ohr, dass heute ein bekannter Kapellmeister dirigiere, sie habe in der Zeitung über ihn gelesen. Es roch nach Jasmin und Akazien, die Gaslaternen – damals noch von allen ‚Aweriwski‘ genannt – verströmten ein weiches Licht. Mutter erzählte, dass sich die Lemberger Studenten und Armen über diese Neuerung nicht besonders freuten, denn aus den alten Laternen hatte man sich Öl ‚ausborgen‘ und mit nach Hause nehmen können. Wenn der alte Jude, der zwischen den Tischen im Restaurant im Jesuiten-Garten herumlief, auftauchte, zog ich bei ihm immer ein ‚Ljos‘. Das liebte ich. So ein Los kostete ein paar Groschen, und man konnte es später gegen eine Packung Schokolade oder eine Handvoll Feigen einlösen. Manchmal durfte ich von Vaters dunklem Bier kosten, woraufhin Mutter die Augen verdrehte, selbst trank sie immer nur ein Seidl, ein kleines Bier. Als ich fünf Jahre alt war, ging mein Vater einmal vor unserem Spaziergang mit mir zum Universitätsgebäude und zeigte mir in den Mauern Einschusslöcher, die mit weißem Mörtel verschmiert worden waren. Die Löcher waren zwei Jahre zuvor entstanden, als polnische Aufständische in den ‚Novembertagen‘ 1918 vom Sankt-Georgs-Hügel her angriffen und die Ukrainer die Universität verteidigten. Am fünften Jahrestag des Aufstands ging mein Vater mit mir zum Abendgottesdienst in der Sankt-Georgs-Kathedrale, bei dem der gefallenen Soldaten gedacht wurde. Es kamen so viele Menschen, dass nicht alle in der Kirche Platz hatten und einige draußen stehen mussten. Ich kann mich sehr gut an den Gottesdienst erinnern. Besonders an sein Ende. Es war bereits das Halleluja zur Melodie eines Soldatenliedes gesungen worden, dreimal Herr erbarme dich und der Cherubim-Hymnus. Der Chor stimmte gerade Unser Mund sei erfüllt von unserem Lob, o Herr von Sitschynskyj an, als plötzlich die berittene Polizei auftauchte und die Menge auseinandertrieb. Ich weiß noch, wie die Menschen vor den Pferdehufen flohen. Wir konnten uns im letzten Moment in einen Torbogen retten.“
Als Sofia älter wurde, war der Kościuszko-Park nicht mehr so interessant für sie. Nun wollte sie um alles in der Welt in den Stryjskyj-Park, der deutlich größer und voller interessanter Winkel war und in den die elektrische Straßenbahn alle brachte, die den Ausstellungsplatz sehen wollten.
Im Stryjskyj-Park schien es Sofia, als führten die Alleen irgendwohin in die Ferne, ins Jenseits. Gerne betrachtete sie den viereckigen, an allen Seiten mit farbigen Flaschen verzierten Turm des Wodkamagnaten Baczewski. Die Erwachsenen diskutierten ständig darüber, ob die Flaschen mit Wasser oder vielleicht doch mit echter Nalywka gefüllt seien. Ein paar Mal nahm der Vater Sofia mit, als er am Tag vor einer Familienfeier zu Baczewskis Fabrik fuhr, um Kornbrand zu kaufen. Neugierig beäugte Sofia das Fabrikgebäude, das einem überdimensionalen Puppenhaus ähnelte, und betrachtete interessiert die Straße, die ganz anders aussah als ihre Sigmundstraße im angesehenen Zentrum. Hier, im Umkreis der Fabrik lebten hauptsächlich Arbeiter – ein eigenes, ewig betrunkenes Volk, das ein wenig an die Lemberger Batjary oder die schrecklichen Ganoven von der Lytschakiwska-Straße erinnerte, mit denen man Sofia als Kind immer gedroht hatte: „Wenn du schlimm bist, kommen die Batjary und nehmen dich mit in ihre Schenke.“ Das klang nicht weniger bedrohlich als Bronislawas: „Wenn du schlimm bist, wirst du später mit herausgestreckter Zunge im Postamt stehen und allen Leuten die Marken ablecken.“ Und obwohl Sofia gern Marken ableckte, weil sie den süßlichen Geschmack des Klebers mochte, wurde ihr bei der Vorstellung, tagelang mit hässlich herausgestreckter Zunge an einem geschäftigen Ort zu stehen, unwohl zumute.
Sie mochte auch den Geruch des Klebers, der in Drohobytsch in der Fabrik Polmin hergestellt wurde, in die Sofias Eltern einmal mit ihr einen Ausflug machten. Dort kauften sie diesen Kleber. Zu Hause klebte Sofia damit ihre Zeichnungen an Fensterscheiben und Schränke, die Mutter aber schimpfte und zwang sie, das Papier wieder abzulösen, was sehr schwierig war. Nachdem Sofia ein paar Stunden verbissen geschrubbt hatte, bat sie Bronislawa um Hilfe. Die hatte wie immer ein Geheimrezept parat: Sie mischte in der Küche einige Zutaten zusammen, löste sie in Wasser auf und entfernte damit den Kleber im Handumdrehen. Währenddessen erzählte sie:
„Weißt du, in Brasilien gibt es einen Brauch: Wenn ein Sklave oder eine Sklavin etwas Böses getan hat und vom Herrn bestraft werden soll, wendet der Übeltäter sich an einen engen Freund des Herrn und ersucht diesen, in einem Brief um das Erlassen der Strafe zu bitten. Diese Person wird dann zum Paten oder zur Patin des Sklaven, der ihm oder ihr in Zukunft keine Bitte ausschlagen darf.“
„Ich habe dich verstanden, Bronislawa“, lachte Sofia. „Worum auch immer du mich bittest, ich werde es tun. Du hast mir schon so oft geholfen, einer Strafe zu entgehen. Obwohl ich ja keine Sklavin bin.“
Beide lachten.
In den Kościuszko-Park gingen sie zu Fuß, in den Stryjskyj-Park fuhren sie mit der Pferdedroschke oder mit der Straßenbahn. Das machte den Stryjskyj-Park noch interessanter. Als Kind liebte Sofia es, mit der Pferdedroschke zu fahren. Die Hufe der Pferde klapperten eindrucksvoll auf dem Kopfsteinpflaster des Zentrums. Sofia schaute aus dem Fenster und betrachtete die vertrauten Straßen aus einer neuen, für Fußgänger unerreichbaren Perspektive. Die Straße vor der Universität war nicht wie alle anderen Straßen mit Stein gepflastert, sondern mit Holz. Auf dem Holz klangen die Pferdehufe anders, gedämpfter, als verschwände oder verlöre sich das Geräusch in den Spalten.
Später fuhr Sofia lieber mit der Straßenbahn. Sie wollte immer so lange wie möglich fahren, deshalb bestand sie darauf, zur einen Endstation, dem Hauptbahnhof, zu gehen und bis zur anderen Endstation, dem Ausstellungsplatz, zu fahren. Von dort war es nicht weit bis zum Stryjskyj-Park. Einmal führte diese fixe Idee fast zu einer Katastrophe.
An jenem Tag ging Bronislawa Pfeiffer mit Sofia spazieren. Sofias Mutter hatte sie einige Jahre zuvor in Dienst genommen, und die beiden wurden gleich gute Freundinnen. Bronislawa half im Haushalt und mit den Kindern.
Sofias Mutter wusste, dass Bronislawa vor langer Zeit ihren Mann, einen Lokführer, verlassen hatte, um mit ihrem Geliebten, einem Archäologen, exotische Länder zu bereisen, und so ihren Traum, die Welt zu sehen, verwirklichte. Ihren früheren Mann, Felix Pfeiffer, mit dem sie offiziell noch immer verheiratet war, erwähnte Bronislawa nie. Dabei arbeitete dieser nach wie vor am Lemberger Hauptbahnhof.
Der Geliebte starb später am Tropenfieber, Bronislawa kehrte nach Lemberg zurück und wurde Dienstmädchen. Sie hatte keine eigenen Kinder, war schweigsam und erwähnte ihre Reisen nur selten und beiläufig. Wenn Sofias Mutter zum Beispiel sehr viele Eier gekauft hatte, riet sie ihr, diese in Kalklauge oder Kohlestaub zu lagern – mit diesem Trick war es ihr gelungen, Eier bis nach Australien zu transportieren, ohne dass sie während der mehrwöchigen Schiffsreise verdarben. Als längst niemand mehr frische Lebensmittel hatte und sich alle mit Zwieback begnügen mussten, kochte Bronislawa für ihren Geliebten Eier und Reis (den sie als Einzige vor Käfern bewahren konnte), dazu gab es frische Ziegenmilch. Sie hatte durchgesetzt, eine Ziege mit an Bord zu nehmen. Bronislawa war ungeheuer stolz auf ihre praktische Veranlagung und ihre Sparsamkeit, dank der sie mit ihrem Geliebten um verhältnismäßig wenig Geld relativ komfortabel reisen konnte.
„Man muss einfach genau lesen, was man unterschreibt“, erzählte sie gerne. Und diesbezüglich war sie sehr geschickt. Etwa war es eine der liebsten Betrügereien von Schiffskapitänen, den Wein an Bord teuer zu verkaufen, obwohl er in der Regel in der Verpflegung während der Reise inbegriffen war, die mit der Fahrkarte bezahlt wurde. Außer Bronislawa hatte kaum jemand diesen Punkt im Kleingedruckten am Ende des Vertrags genau gelesen. So bezahlten viele Passagiere horrende Summen für schlechten Wein, nicht aber Bronislawa.
Außerdem nahm sie immer bunte Bettwäsche auf Reisen mit, denn sie beobachtete Folgendes: Händigte man den Wäschern an Bord weiße Bettwäsche aus, fand diese garantiert nicht zu ihrem Besitzer zurück, stattdessen bekam man alte, abgenutzte Bettwäsche.
An jenem Tag war Felix Pfeiffer wie immer zum Rauchen nach draußen gegangen. Von seinem Plätzchen aus war die Endstation der elektrischen Straßenbahn gut zu sehen. Schon vor einigen Jahren hatte sie die frühere Pferdetram abgelöst. Das gefiel Felix. Nun waren die Straßen sauberer, die Straßenbahn fuhr deutlich schneller und man brauchte keine Angst zu haben, dass die Pferde scheuten und die Waggons umkippten. Felix hatte fast fertig geraucht, als er einen letzten Blick auf die zur Mittagszeit menschenleere Haltestelle warf. Plötzlich erstarrte er. In einer Frau, die ein kleines Mädchen an der Hand hielt, erkannte er Bronislawa. Zuerst meinte er, sich getäuscht zu haben, doch im nächsten Moment begann sein Herz schneller zu schlagen – er hatte nicht erwartet, dass diese schamlose Frau, die ihm das Herz gebrochen hatte, nach so vielen Jahren in ihm noch Gefühle hervorrufen würde. Nun wurde er neugierig. Einen Moment zögerte er noch, doch dann lief er schnell zur Haltestelle.
Die Straßenbahn kam. Die Frau – es war tatsächlich Bronislawa – stieg mit dem Kind, das ihr überhaupt nicht ähnlichsah, in den ersten Waggon. Felix stieg in den zweiten. Er schaute bei jeder Station aus dem Fenster, um sofort aus der Straßenbahn springen zu können, wenn Bronislawa und das Mädchen ausstiegen. Aber sie fuhren bis zur Endstation, dem Ausstellungsplatz. Felix folgte Bronislawa und dem Mädchen in den Stryjskyj-Park und suchte dabei hinter den Rücken der wenigen Fußgänger Deckung. Wie immer lief Sofia zuallererst zu dem Mann der Lotterie „Kolo schastja“ und kaufte ein „Ljos“. Sie hüpfte vor Freude, als sie ihren Gewinn – einen doppelseitigen Taschenspiegel – bekam, und blendete Felix im nächsten Moment damit. Er blinzelte, hob seine Hand zum Schutz und fluchte leise.
„Du hättest dir besser ein Bonbon kaufen sollen“, tadelte die sparsame Bronislawa.
„Ich tausche den Spiegel morgen im Hof gegen drei Bonbons“, lachte Sofia, und sie spazierten weiter die Parkallee entlang.
Bronislawa erzählte Sofia, wie sie auf ihrer Reise zum Äquator zum ersten Mal im Leben fliegende Fische gesehen hatte.
„Sind sie bunt?“, fragte das Mädchen.
„Nein, grau. Sie sehen ein bisschen aus wie Heringe, haben aber Flügel“, antwortete Bronislawa.
„Und springen sie hoch?“
„Beim ersten Mal hat mich die Sonne so geblendet, dass ich kaum etwas ausmachen konnte. Aber dann wurden die Fische immer an Deck geweht, und am Morgen fanden wir sie. Anders fängt man sie auch nicht, nur wenn der Wind sie an Bord weht. Sie können richtig hoch springen, aber meistens fliegen sie knapp über dem Wasser, und das ziemlich weit.“
„Habt ihr Meeresfrüchte gefangen, als ihr auf dem Schiff wart?“
„Nur einmal“, antwortete Bronislawa. „Ein sehr schönes Exemplar, sie nannten es Fisolida. Violett, mit einem langen Kamm. Es gefiel mir so gut, dass ich ein Netz bastelte und es fing. Ich wollte es malen. Aber als es trocknete, wurde es durchsichtig und lief aus. Es tat mir leid, etwas so Schönes zerstört zu haben, danach fing ich keine mehr.“
Felix folgte ihnen heimlich, und jedes Mal, wenn er glaubte, Bronislawa würde sich umdrehen, versteckte er sich hinter einem Strauch. Er versuchte nicht daran zu denken, was ihm sein Chef erzählen würde, wenn er seinen eigenmächtigen Ausgang, der lange zu dauern versprach, bemerkte. Felix hoffte, das Mädchen würde bald müde und hungrig nach Hause gehen wollen. Doch es verspeiste mit großem Appetit eine große mitgebrachte Breze und lief unermüdlich die Parkalleen entlang. Felix schmerzten vor Müdigkeit bereits die Beine …
Als sie schließlich zur Straßenbahnstation zurückkehrten, stiegen Bronislawa und Sofia wieder in den ersten und Felix in den zweiten Waggon. Wieder schaute er aus dem Fenster, um jederzeit aus der Straßenbahn springen zu können, doch auch diesmal fuhren sie bis zur Endstation. Felix blickte leidvoll zum Bahnhof hinüber, wo ihn seine Arbeitskollegen bestimmt schon suchten, trotzdem folgte er Bronislawa und Sofia weiter bis in die Sigmundstraße. Und mit jedem Schritt wurde ihm klarer, dass vermutlich das Mädchen diese Route vorgab, weil es so gerne mit der Straßenbahn fuhr. Nachdem Felix gesehen hatte, in welchem Haus Bronislawa verschwand, rannte er schnell zum Bahnhof. Er war fast zwei Stunden weg gewesen. Zum Glück genau in der Mittagspause seines Chefs, der an jenem Tag eine Verabredung zum Mittagessen gehabt hatte, dort ein Seidl mehr als sonst getrunken und sich deshalb länger aufgehalten hatte. Als er danach etwas angeheitert zur Arbeit zurückkehrte, bemerkte er Felix’ Abwesenheit nicht sofort, und so kam dessen vorsorglich zurechtgelegte Ausrede, er sei überraschend zur Reparatur des alten Zuges „Jaroslaw“ gerufen worden, nicht zum Einsatz. Jaroslaw war jener legendäre Zug, der vor über fünfzig Jahren als erster auf den Schienen der neuen Lemberger Bahnstrecke gefahren war. Nun verkehrte er nicht mehr, doch vor kurzem hatte man beschlossen, ihn zu reparieren, um am Wochenende die Lemberger Kinder damit nach Brjuchowytschi zu bringen.
Jetzt wusste Felix, wo seine Frau wohnte. Drei Tage später, am Samstag, stand er vor dem Haus und läutete an. Eine große, etwa vierzigjährige Frau öffnete ihm, Sofias Tante, bei der Sofia und Bronislawa mittwochs immer zu Mittag aßen. Der verwirrte Felix wusste nicht, was er mit den Blumen tun sollte.
„Sind die für mich?“, fragte die Tante lächelnd.
Felix überreichte ihr wortlos die Blumen. Und so begann ihre Affäre, welche die Tante über Jahre hinweg vor ihrer Familie geheim hielt. Und Felix’ Bemühungen, Bronislawa zu finden, hatten damit ein Ende gefunden.
Sofia aß nicht gerne bei der alleinstehenden, reichen Tante, die ständig von ihren Krankheiten sprach. Nach dem Essen aber bekam Sofia von der Tante immer eine Sechsgroschenmünze, und das war ein stichhaltiges Argument. Dafür konnte man im Kościuszko-Park eine große Breze oder andere Schätze kaufen. Deshalb war Sofia sogar bereit, das ekelhaft stinkende Pfefferminzbonbon zu lutschen, das ihr die Tante gegen alle Einwände der Mutter jedes Mal vor dem Essen aus einer goldenen Metalldose gab.
Als Nachtisch gab es bei der Tante oft Kirsch- oder Marillenkompott, das man in großen Gläsern kaufen konnte. Außerdem Bananen, Orangen und andere Leckereien aus Orensteins Laden. Zu besonders feierlichen Anlässen gab es Süßigkeiten aus den Konditoreien Ludwig Salewski oder Welz. Beide befanden sich relativ weit weg, in der Akademiestraße. Man erzählte, dass Salewskis Eclairs täglich mit dem Flugzeug in die Warschauer Filiale der Konditorei geliefert wurden!
Mehr noch als die Eclairs liebte Sofia bei Salewski jedoch die Pralinen „Tajojka“, denn ihre Mutter hatte ihr erzählt, dass der Name vom Ausruf „ta joj“ kam, mit dem die Lemberger allerlei Emotionen ausdrückten: Verwunderung, Entrüstung, Misstrauen, Schreck, Begeisterung. Das billigste Eclair bei Salewski kostete fünfundzwanzig Groschen, und das brachte Sofia in eine echte Zwickmühle: Sollte sie das winzige Gebäck bei Salewski kaufen oder eine große Packung Halva im Kiosk von Kawuras am Heiligen-Geist-Platz? Müsste Sofia selbst entscheiden, würde sie bestimmt die Packung Halva nehmen, alleine weil mehr drin war. Aber das Eclair schmeckte natürlich viel besser.
Am liebsten von allen Süßigkeiten hatte Sofia jedoch das italienische Eis in der Mikolasch-Passage. Sofia wählte jedes Mal Schokolade, obwohl sie sich immer vornahm, das nächste Mal eine andere Sorte zu probieren. Ebenso bestellte sie in der Konditorei Bieniecki in der Jagiellonen-Straße, nicht weit von ihrem Haus, konstant Sahne- und Himbeer-Eis (je eine Kugel). Zu Bieniecki ging Sofia manchmal mit ihrem Vater nach dem gemeinsamen Nachmittagsspaziergang. Und mit der Mutter, nachdem sie vor Weihnachten oder Ostern ihre Mehl-, Zucker- und Wurstbestellung erledigt hatten. Die Mutter erzählte, dass die Konditorei Bieniecki einst die beliebteste Konditorei der Stadt gewesen sei und sich in einem prunkvollen Haus im Zentrum, unweit der Oper, befunden habe, damals habe es dort das beste Eis in ganz Lemberg gegeben. Doch Sofia war mit der späteren, deutlich bescheideneren Konditorei Bieniecki vollkommen zufrieden und freute sich besonders, wenn der Kellner ihr zum Eis Waffelröllchen schenkte, die so lecker knackten.
Die Feierlichkeiten zu Weihnachten und Ostern hatten einen besonderen Platz in Sofias Kindheitserinnerungen. Es waren die wichtigsten Ereignisse des Jahres, die sich ihr bis ins kleinste Detail einprägten.
Die Weihnachtsvorbereitungen beschränkten sich nicht auf das Bestellen von Lebensmitteln, sondern verwandelten sich stets in ein pompöses kulinarisch-theatralisches Geschehen. Sofia liebte es, wenn die Mutter ihr erlaubte, sich zu ihr an den Tisch zu setzen, oder ihr gar die Aufgabe übertrug, die Einkaufsliste für die Feiertage zu schreiben:
- zwei Kilo Walnüsse
- ein Pfund Schokolade
- ein Kilo Mandeln
- ein halbes Pfund Aranzini
Sofia sorgte sich stets, es könnte zu wenig Leckereien geben, und fragte einige Male bei der Mutter nach, ob die Torten auch gelängen, wenn man beim Backen zu wenig Schokolade habe. Die Mutter lächelte, tadelte sie mit dem Finger und sagte:
„Zu Hause sperren wir das alles weg.“
Doch Sofia wusste, dass das nicht helfen würde, wenn es um die Plätzchen ging. Jeder Beutel würde am Ende ein bisschen leichter sein als noch im Laden. Die Mutter würde Sofia dann einen strengen Blick zuwerfen, und die würde mit den Schultern zucken, als wollte sie sagen, was soll ich tun, die Beutel haben eben Löcher! Doch die Mutter würde ihr nicht glauben und in ihren Taschen noch Wochen später Rosinen, Schokoladenstückchen und Mandeln, von denen sie die Haut hatte ablösen dürfen, finden.
Zu den Feiertagen holte die Mutter die alten Rezepthefte heraus, die sie von ihrer Mutter bekommen hatte. Darin fand man sorgfältig niedergeschrieben, die Tinte bereits verblichen, die größten Weihnachtsgeheimnisse: auf Ukrainisch (noch mit Härtezeichen), auf Deutsch (von Sofias Großmutter Genja, der Frau eines griechisch-katholischen Priesters) und auf Polnisch (von ihrer Urgroßmutter Renata, die mit einem deutschen Advokaten verheiratet gewesen war). Die Mutter brachte Sofia bei, sich nicht allzu genau an die Rezepte zu halten und immer dem eigenen Gefühl zu vertrauen, denn die kulinarische Kunst hieß es weiterzuentwickeln – wie auch jede andere. Es war sinnlos, sie zu fragen, was und wie viel sie einer Speise hinzufügte, denn als Antwort zuckte die Mutter immer mit den Schultern und sagte: „so viel der Teig aufnimmt“ oder „nach Gefühl“. Sofia bemerkte jedoch einige Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel nahm die Mutter dort, wo das Rezept mehrere Dutzend Eier verlangte, immer nur ein paar Eier und ein paar hundert Gramm Butter, wenn im Rezept ein Kilo stand.
„Soll das Wein sein?“, fragte Bronislawa gedankenversunken und zog an ihrer Papirossa, während sie die in der Weinhandlung Stadtmiller in der Krakauer-Straße gekauften Flaschen in der Vorratskammer verstaute.
Sofia begleitete Bronislawa immer in die Weinhandlung. Sie beobachtete gerne, wie die in gelbes Papier gewickelten Flaschen mit einem Miniaturlift aus dem Keller geholt wurden.
„Jede Flasche kostet ein kleines Vermögen. Der wird nur zu Weihnachten und Ostern gekauft, und man genießt jeden Schluck“, führte Bronislawa weiter aus. „Die Franzosen und Spanier würden sich krummlachen.“
Bronislawa seufzte verträumt, das machte sie immer, wenn sie an ihre Reisen dachte. Sofia wusste, dass sie nun den Fischmarkt in Barcelona vor sich sah, neben dem sie mit ihrem Geliebten, dem Archäologen, eine Zeitlang gewohnt hatte. Jeden Morgen ging Bronislawa auf diesen Markt und beäugte entsetzt die sonderbaren, noch lebenden Geschöpfe, die eben aus dem Meer gefischt worden waren. Und jeden Morgen schenkte ihr ein hübscher junger Fischer, der seinen Fang hier verkaufte, ein Gläschen Wein ein, zwinkerte ihr zu und zeigte ihr seinen besten Fisch. Vom Wein beflügelt kaufte sie alles, was er ihr anpries, notierte sein einfaches Rezept („so viel Rosmarin und Zitrone wie möglich, das ist das Wichtigste“) und trug den Fisch nach Hause, um ihn zuzubereiten.
„Ich habe es nie bereut“, erzählte Bronislawa stolz. Nie vertraute sie die Zubereitung des Fischs, den sie nur wenige Stunden vor dem Weihnachtsabend sorgfältig auswählte, jemand anderem an. Und jedes Mal beschwerte sie sich, dass man den hiesigen Fisch nicht mit Salzwasserfisch vergleichen könne. Sie feilschte begeistert, zu Hause trennte sie die Flossen mit einem scharfen Messer ab und gab sie Sofia.
Die Flossen trocknete Sofia auf dem Ofen und tauschte sie später im Hof bei einem Jungen gegen Bonbons. Noch zwei Wochen nach Weihnachten bewarfen sich die Jungen gegenseitig mit Fischflossen, manchmal bewarfen sie auch die Mädchen, denen sie auf dem Heimweg auflauerten.
Trockenfrüchte kaufte die Mutter immer im Voraus auf dem Markt, bei den Bojken aus Werchnje Synjowydne.
„Mutters Weihnachtswareniky und Krauttaschen schmeckten sehr gut, Vater röstete zum Wodka in einem Topf Zimt mit Honig an“, erzählte Großmutter Sofia Halyna und ein Schleier der Nostalgie legte sich über ihre Augen. „Alle versammelten sich um den Tisch, auch Bronislawa. Wir aßen Prosphora: zuerst Vater und Mutter, sie wünschten einander ein gutes Jahr, dann alle anderen. Es gab Borschtsch, Pfannkuchen mit Pilzfüllung, Krautrouladen und Fisch, den die Mutter für mich von den Gräten befreite. Weihnachtslieder wurden gesungen. Zunächst Allewiger Gott und Gott ist geboren, danach alle anderen. Am Morgen des Christtags achtete man penibel darauf, dass ein Mann als Erstes das Haus betrat und nicht eine Frau. Sogar die Milchfrau schickte an diesem Tag ihren Mann, selbst wenn dieser murrte, weil er eine Weiberangelegenheit erledigen musste. Doch vor der Milchfrau kam oft der Wächter mit Stroh, das er irgendwo aufgetrieben hatte, denn er wusste, dass er bei seinem Besuch ein Gläschen guten Kornbrand von Baczewski bekommen würde.“