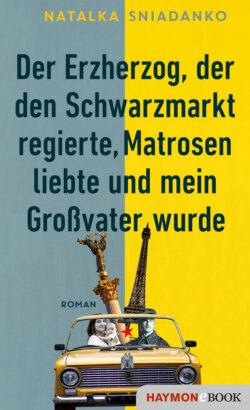Читать книгу Der Erzherzog, der den Schwarzmarkt regierte, Matrosen liebte und mein Großvater wurde - Natalka Sniadanko - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1969–2008
ОглавлениеHalyna kam am 18. August 1969, eine Stunde vor Mitternacht zur Welt. Am gleichen Tag, genauer gesagt, in der gleichen Nacht, einundzwanzig Jahre davor war im Krankentrakt eines Kiewer Gefängnisses der Totenschein ihres Großvaters ausgestellt worden – ukrainischer Oberst, Truppenführer bei den Sitsch-Schützen, in Paris zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, in Wien der österreichischen Staatsbürgerschaft entledigt, nach jungen Matrosen und reizenden Damen schmachtender Besucher Pariser Bordelle, Spion des englischen und französischen Geheimdienstes, Sympathisant der Organisation Ukrainischer Nationalisten: Erzherzog Wilhelm von Habsburg-Lothringen.
Für Halyna war er Großvater Wilhelm, manchmal auch Wiljus. Wiljus wurde er in seiner Kindheit genannt und dann wieder im hohen Alter. Wilhelm, der jüngste Sohn Karl Stephans von Habsburg-Lothringen, wurde am 10. Februar 1895 geboren, ein halbes Jahr bevor Sigmund Freud seinen berühmten Traum von Irmas Injektion hatte. Dieser veranlasste Freud zu der Schlussfolgerung, dass jeder Traum einen Wunsch erfüllt. Löste seine Theorie zu Beginn einen Skandal in der wissenschaftlichen Welt aus und weckte Misstrauen, machte sie Freud später zu einem weltberühmten Wissenschaftler.
„Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, fällt mir zuerst das Meer ein. Das viele Wasser. Es faszinierte mich“, schrieb Wilhelm in seiner Autobiografie, deren Sprache Halyna nur teilweise verstand, so viele verstümmelte deutsche und polnische Worte benutzte er. Zum Beispiel begriff sie nicht sofort, dass der Großvater mit „Marynarka“ nicht Sakko, sondern Meeresflotte meinte, dass „Reparazija“ Operation hieß, „Belfer“ Lehrer und dass der Großvater zu Uhren „Dsygar“ sagte. Die Uhr des Großvaters zeigte immer um eine Stunde weniger an als Halynas Uhr. Wilhelm und Großmutter Sofia hatten die von der sowjetischen Macht eingeführte Zeit nie übernommen. Und wenn sie mit jemandem ein Treffen vereinbarten, fragten sie immer nach, ob es sich um „Moskauer Zeit“ handle.
Ebenso plötzlich und spontan, wie der Großvater fast alles in seinem Leben entschied, beschloss er, seine Memoiren zu schreiben. Eines Winters hatte Halyna Windpocken und konnte wochenlang nicht zur Schule gehen. Wilhelm saß an ihrem Bett, bepinselte die roten Pusteln sorgfältig mit einer Tinktur und erzählte Geschichten aus seinem Leben, um die Enkeltochter vom Juckreiz, den sie am ganzen Körper verspürte, abzulenken.
„Großvater, du erzählst mir Märchen, das kann alles nicht wahr sein“, nörgelte Halyna. „Du erzählst mir einen Abenteuerroman, den du gelesen hast.“
Damals beschloss Wilhelm, dass seine Biografie ein Abenteuerroman sei, den er selbst zu Papier bringen würde.
Die feierlichen Vorbereitungen zum Schreiben seiner Memoiren dauerten fast einen Monat. Lange richtete Wilhelm sein Arbeitszimmer ein. Früher war es das Büro von Großmutter Sofias Vater gewesen, in das er sich nach der Arbeit zurückzog. Dort stand ein mit grünem Filz überzogener Tisch mit zahlreichen Schubladen, deren Schlüssel fast alle noch vorhanden waren.
Bevor Wilhelm mit der Arbeit an seinen Memoiren begann, wollte er für seinen Stuhl das gemütlichste Kissen, doch keines passte, vergeblich probierte er verschiedene Varianten. Er ließ den Stuhl sogar neu bespannen, doch auch das machte ihn nicht glücklich. Er versuchte, es sich in einem der tiefen Lederfauteuils gemütlich zu machen, die zwischen Armlehne und Sitzfläche einen ziemlich großen Spalt ließen. Als Kind hatte Sofia in diesem Spalt oft allerlei Kleinkram gefunden: Münzen, kleine Feilen oder Löffel, Kämme.
Wilhelm wechselte die Vorhänge im Arbeitszimmer, um eine behagliche Atmosphäre zu schaffen, und wählte langmächtig Papier, Füllfeder und Bleistifte aus. Er zeigte Halyna alles und beratschlagte sich mit ihr. Sie borgte ihm für seine Notizen ein paar ihrer dicken, karierten Hefte. Doch Wilhelm erklärte, dass er in Heften mit Kunstledereinband im depressiven Farbton von roter Bete sicher nichts Bedeutendes würde schreiben können. Halyna schlug vor, das Heft mit Papier einzubinden und zu bemalen. Das machten sie auch. Schließlich verkündete Wilhelm, dass er am nächsten Tag mit der Arbeit an seinen Memoiren beginnen würde.
Am folgenden Morgen gleich nach dem Frühstück erklärte er:
„Heute will ich nicht gestört werden. Ich werde schreiben.“ Stolz ordnete er seinen Schlafrock und verschwand im Arbeitszimmer.
Er hatte Großmutters alte Schreibmaschine ins Zimmer geschleppt und bemühte sich, nun schnelles Tippen zu lernen. Zuerst hörte man aus dem Arbeitszimmer ein paar Minuten lang das Klappern der Tasten, daraufhin ein lautes Rumpeln – vielleicht mit dem Stuhl –, dann rief Wilhelm auf Deutsch:
„Verdammt noch mal!“
Vielleicht war eine Taste stecken geblieben, oder er hatte sich vertippt. Nach etwa einer Stunde kam er leicht verärgert aus dem Arbeitszimmer und fragte Großmutter, ob sie etwas Leckeres für ihn habe, denn das Schreiben gehe ihm nicht von der Hand. Die Großmutter bereitete ihm Tee, ein Marmeladebrot und Quark mit saurer Sahne zu – sein Lieblingsdessert. Wilhelm verschwand im Zimmer. Eine weitere Stunde verging und er erschien erneut. Diesmal war er finster entschlossen:
„Wie soll man im Schlafrock schreiben!“, rief er beim Herauskommen und öffnete ruckartig die Tür des Kleiderschranks. „Kleider machen Schreiber. Ich muss mich zurechtmachen.“
Dann begann er sich lange umzuziehen, zu waschen, zu frisieren, zu rasieren und zu maniküren – Letzteres machte der Großvater immer sehr sorgfältig. Brüchige, abgebissene und schmutzige Nägel oder eine harte Nagelhaut brachten ihn zur Weißglut. Seine Maniküre war ziemlich zeitaufwendig, diesmal dauerte sie bis zum Mittagessen. Dafür nahm er das Essen festlich gekleidet ein. Der Großvater hatte in einer Schublade sogar seine Schweizer Uhr gefunden, die seine Inhaftierung auf wundersame Weise überdauert hatte, er befreite sie vom Staub und band sie sich ums Handgelenk. Er hatte die Uhr viele Jahre nicht getragen. Nach dem Essen seufzte Großvater zufrieden und sagte:
„Und jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus!“
Dann ging er ins Arbeitszimmer, um seinen Mittagsschlaf zu halten. Später trank er Kaffee, spielte mit Halyna Schach, las und erwähnte das Schreiben an diesem Tag nicht mehr. Am nächsten Morgen wiederholte sich die ganze Prozedur. Solange Halyna krank war, schrieb er dennoch ein paar Seiten. Mit jeder einzelnen kam er aus dem Arbeitszimmer gelaufen, glücklich und aufgeregt wie ein Kind, zog den Gürtel seines Schlafrocks enger und las sie Halyna vor. Jedem Satz fügte er eine lange Erklärung bei, ohne die das Geschriebene kaum zu verstehen gewesen wäre. Wilhelm konnte deutlich besser erzählen als schreiben. Beim Schreiben bereitete ihm jeder Satz große Schwierigkeiten, er quälte sich beim Formulieren einfacher Gedanken, suchte nach Wörtern, strich und korrigierte, trotzdem war der Text verworren und nicht immer verständlich. Wilhelm erklärte sich das durch das Fehlen einer gymnasialen Bildung, denn er war nach dem Programm der Realschule und nicht des Gymnasiums unterrichtet worden. Die Hauslehrer seiner Kindheit wollten vor allem auf den Vater, aber auch auf die Kinder selbst einen guten Eindruck machen. Sich darum zu kümmern, ob die Schüler den Stoff beherrschten, war zweitrangig. So eigneten sich die Kinder das an, was ihnen leichtfiel. Und Willy fiel es leichter zu erzählen, als zu schreiben. Das Schreiben eines Aufsatzes sah bei ihm so aus: Er erzählte der Lehrerin eine ganze Schulstunde lang von seinen Sommerferien und beschrieb dabei die allerkleinsten Details seiner Reise mit den Eltern nach Paris, den Buttergeschmack der frischen Croissants, den singenden Tonfall der Pariser Kellnerinnen und Zimmermädchen in den Hotels, den Staub auf den Straßen, die Roben der Damen im Theater sowie die Abenteuer der An- und Abreise. Die Lehrerin lauschte ihm mit angehaltenem Atem. Dann sagte sie:
„Wunderbar, Willy! Und jetzt schreib das alles auf.“
Ein paar Minuten später händigte er ihr zufrieden lächelnd den Zettel aus und sagte:
„Fertig!“
„Wie? Schon? So schnell?“, fragte die Lehrerin erstaunt, faltete den Zettel auseinander und las: „Ich habe die Ferien in Paris verbracht. Dort war es schön.“
„Das ist alles?“, wunderte sie sich weiter.
„Den Rest habe ich Ihnen erzählt“, lächelte Willy breit und war mit sich selbst sehr zufrieden.
Das Schreiben war Wilhelm schon als Kind schwergefallen. Bereits die Schönschreibstunden hatte er gehasst und sich wann und wie auch immer möglich davor gedrückt. Aufsätze schrieb er später ebenso ungern; er fand es langweilig, so viel Zeit für etwas zu verschwenden, das er sich auch so vorstellen konnte. Seine Unfähigkeit, sich lange auf eine Sache zu konzentrieren, ließ später auch seine mündlichen Erzählungen chaotisch und unvollständig erscheinen. Manche Episoden erwähnte er oft und detailliert, andere ließ er weg. Deshalb hatte Halyna eine ziemlich bruchstückhafte Vorstellung vom abenteuerlichen Leben ihres Großvaters – ein ähnlicher Eindruck wie beim Schauen alter Dokumentarfilme, die immer wieder reißen: Mit dem Film verknittern auch die Eindrücke und fügen sich an den überraschendsten Stellen wieder zusammen. Während Halyna den chaotischen Erzählungen lauschte, begann sie zu zeichnen. Zuerst nur Gesichter – sie versuchte sich vorzustellen, wie all die Menschen aus Großvaters Erzählungen ausgesehen hatten –, dann einzelne Szenen: Der Großvater langweilt sich als kleiner Junge bei einer höfischen Zeremonie in Wien. Er flüchtet aus dem Schloss der Familie im polnischen Saybusch in die Berge, zu den Huzulen. Er erweist den Soldaten aus seinem ukrainischen Regiment der Sitsch-Schützen die Ehre. Trifft den Metropoliten Scheptyzkyj. Probiert in Paris ein neues Kleidungsstück an. Die Skizzen in ihren Heften erinnerten an Comics, mit dem einzigen Unterschied, dass die Geschichten nicht chronologisch geordnet waren. Nach Ereignissen des Zweiten Weltkriegs kamen mitunter Szenen aus dem Ersten Weltkrieg oder aus der Zwischenkriegszeit, dann Episoden aus dem sowjetischen Lemberg und danach aus den Dreißigerjahren, als Wilhelm in Paris lebte. Diese Comics erinnerten an die Erzählungen des Großvaters und an ihn selbst. Sie waren die Verkörperung von Chaos, Unordnung und aufbrausendem, ungezügeltem Temperament. Außerdem traten die Ereignisse in seinem Leben mit sehr ungleichmäßiger Intensität ein: Zwischen 1914 und 1921 erlebte er dutzende Male mehr und Bedeutenderes als in den darauffolgenden zwanzig Jahren, darauf folgte ein erneutes kurzes Aufflammen intensiven Lebens und danach die Lethargie der Sowjetära.
Dem Großvater gefielen Halynas Zeichnungen sehr. Wenn er ihre Bilder betrachtete, fielen ihm immer neue Details ein, die sie sofort festhielt – manchmal erriet sie ganz intuitiv, wie das eine oder andere ausgesehen haben könnte. Noch als Kind füllte Halyna mit ihren Comics mehrere dicke Hefte, die sie hütete wie einen Schatz. Von Zeit zu Zeit malte sie Episoden aus Großvaters Erzählungen dazu, die in ihrem Gedächtnis auftauchten. Ebendiese Comics würde sie viele Jahre später nach Wien mitnehmen, um sie einem Auftraggeber als Vorschlag für die Gestaltung des Interieurs einer Bar zu zeigen. Dieser sollte sofort Feuer und Flamme sein und Halyna nur eine Stunde nach ihrem Treffen per E-Mail den Vertrag schicken, mit einem Honorar, das ein Ablehnen unmöglich machte. Und sie lehnte nicht ab.
Auf der ersten Seite von Halynas Comics prangte die Uhr des Großvaters, eine „Omega Seamaster“. Genau so eine sah Halyna später im Kino am Handgelenk von James Bond. In diesem Film hörte sie auch zum ersten Mal die Phrase „Die Welt ist nicht genug“, die der Großvater seinen Memoiren als Motto vorangestellt hatte, aber nicht, weil er James-Bond-Filme mochte, sondern weil es das Familienmotto der Habsburger gewesen war.