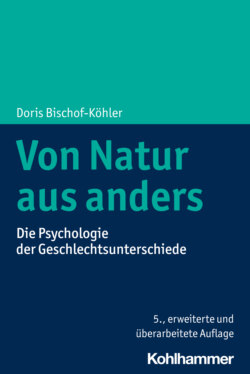Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.5 Geschlecht als Morphologie
ОглавлениеDie durchgängig beobachtbare Tendenz, angesichts von Geschlechtsunterschieden die Allmacht der Sozialisation zu beschwören und eine biologische Verursachung überhaupt gar nicht erst zu erwägen, lässt den Verdacht aufkommen, dass hinter dem, was oberflächlich als Desinteresse erscheint, tiefer gründende Berührungsängste lauern. Falls das zutrifft, müssen wir deren Ursachen genauer analysieren.
Dabei macht sich hinderlich bemerkbar, dass »Biologie« ein Reizwort ist, das, wenn es überhaupt thematisiert wird, selten eine sachliche Behandlung erfährt. Im Folgenden wollen wir zunächst Revue passieren lassen, was unter dieser Wortmarke alles verstanden bzw. missverstanden zu werden pflegt, um dann den Ursachen der eigentümlichen Aversion nachzugehen.
Recht weit verbreitet ist eine häufig von soziologischer und feministischer Seite vertretene Einstellung, die sich vordergründig als »aufgeklärt« charakterisieren ließe; sie wurde u. a. von Margaret Mead vertreten.»Biologie« wird hier praktisch synonym mit Anatomie verstanden, im Falle der Geschlechtlichkeit also konkret mit dem berühmten »kleinen Unterschied« der Fortpflanzungsorgane einschließlich der unmittelbar daran gebundenen Aktivitäten.
Selbstverständlich, sagen die Vertreter dieses Standpunktes, spielt diese »Biologie« eine Rolle. Als Wesen mit Selbstbewusstsein reflektieren wir die Tatsache unserer Geschlechtlichkeit und die unterschiedlichen Funktionen bei der Fortpflanzung. Daraus lassen sich geschlechtsspezifische Aufgaben ableiten, die eine Rollenteilung der traditionellen Form nahelegen, und das führt schließlich zu einem unterschiedlichen Selbstverständnis der Geschlechter. Dieses Erklärungsmuster ist kurz gefasst der Kern der sozialen Rollentheorie, die – auf Talcott Parsons zurückgehend – derzeit insbesondere von Alice Eagly vertreten wird (Eagly, 1987). Konkret stellt man sich das so vor, dass die Menschen wahrgenommen haben, wie Männer sich aufgrund ihrer physischen Ausstattung anders verhalten als Frauen, was sich in einer Arbeitsteilung manifestiert. Aus dieser Erfahrung wird abgeleitet, dass die Geschlechter sich auch psychologisch unterscheiden, und daraus entwickeln sich die Geschlechtsrollenvorstellungen und diesbezügliche Verhaltensanforderungen. Aufschlussreich für diesen theoretischen Ansatz ist es, dass die Rolle der Biologie auf den physischen Bereich beschränkt gesehen wird. Psychologische Unterschiede werden ausschließlich als soziales Phänomen gedeutet (Eagly & Wood, 2009). Dass in solchen Zuweisungen indessen zutreffende Einsichten zum Ausdruck kommen könnten, es sich also um mehr als nur um Unterstellungen handelt, die Möglichkeit der biologischen Evolution von psychologischen Verhaltensdispositionen wird nicht erwogen.
Der Biologie wird in dieser Konzeption also zwar eine gewisse Bedeutung zugebilligt, die sie für das menschliche Verhalten haben kann – dies aber nur, wenn es der Gesellschaft auch gefällt, dies überhaupt zur Kenntnis zu nehmen und zum Gegenstand der Interpretation zu machen. Aber natürlich bleibt es den Kulturen anheimgestellt, wie sie ihre Geschlechtsrollen bestimmen; diese sind also relativierbar, besonders heute, wo die Biologie »funktionslos« geworden ist, weil wir Mittel gefunden haben, ihren »Zwängen« zu entkommen.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass die Selbstdefinition mittels der Geschlechtsrollen nicht – wie aufgrund der sozialen Rollentheorie zu erwarten wäre – in Kulturen mit traditioneller Aufteilung am stärksten ausgeprägt ist, sondern in den eher egalitären Kulturen, bei denen sich die Geschlechter eigentlich mehr Angleichung erlauben könnten (Guimond, 2007; Lippa, 2010). Auch die Kinder im schwedischen geschlechtsneutralen Kindergarten zeigten tendenziell eine Fokussierung auf die Kategorie »Geschlecht«, wenn die Aufgabe hinreichend subtil war. Warum das so sein könnte, wird uns später noch eingehender beschäftigen: Der Befund weist indessen darauf hin, dass die Übernahme der Geschlechtsrolle nicht dann besonders pointiert vollzogen wird, wenn es eine besonders ausgeprägte Stereotypisierung eigentlich nahelegen würde.