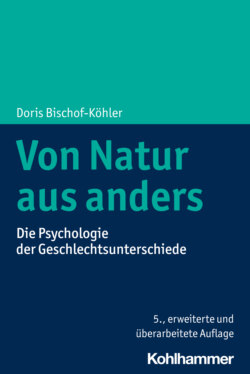Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.11 Repressive Korrektheit
ОглавлениеEin Bereich, in dem man eine Veränderung der Geschlechtsrollen für besonders erfolgversprechend hält, ist die Sprache, der eine dominante Funktion bei der Ausbildung des Bewusstseins allgemein und damit auch des Bewusstseins der Geschlechtlichkeit zugemessen wird3. Dementsprechend erwartet man von der Entsexualisierung der Sprache eine besondere Wirkung, wie sich dies in der Öffentlichkeit ja inzwischen auch unübersehbar in der Vorschrift bemerkbar macht, neben den männlichen auch die weiblichen Bezeichnungen zu verwenden oder radikal gleich nur die letzteren.
Das kann Stilblüten von unfreiwilliger Komik produzieren, so etwa, wenn eine große deutsche Universität ihre Studienanfänger in einem Rundschreiben mit »Liebe Erstsemesterinnen und Erstsemester« anredet. Unangenehmer wird es, wenn sich dieser Druck mit Sanktionen verbindet. Es gilt als »politisch unkorrekt«, Begriffe zu gebrauchen, die so etwas wie Verhaltensunterschiede zwischen den Geschlechtern auch nur von Ferne suggerieren könnten. So erlebt man, dass in wissenschaftlichen Veröffentlichungen ohne Rücksprache mit dem Autor von Verlagsmitarbeitern das Personalpronomen »she« bzw. »he« pauschal durch die Mehrzahlform »they« ersetzt wird, die als einzige für »unschuldig« genug gilt. Wenn dabei der Sinn des Inhalts entstellt wird – was soll’s; der Autor hat es klaglos zu schlucken. Ein deutscher Wissenschaftsverlag verfolgt mittlerweile ebenfalls eine ähnliche Praxis. Im Namen der Geschlechtergerechtigkeit dürfen Schüler nicht mehr »Schüler« genannt werden, sondern nur noch »Schüler*innen«, »Schüler_innen«, »Schülerinnen und Schüler« oder »SuS«, wobei Letzteres nur noch für Eingeweihte ohne Weiteres verständlich ist. Das generische Maskulinum »Schüler«, das Mädchen wie Jungen gleichermaßen meint und grammatikalisch korrekt ist, gilt als nicht mehr akzeptabel.
Auch öffentliche Einrichtungen scheuen neuerdings weder Kosten noch Mühen, sich den neuen Sprachgewohnheiten eines Teils der akademischen Klasse anzupassen. Viele Studentenwerke benennen sich, teilweise auf Anweisung der jeweiligen Hochschulleitung, in »Studierendenwerk« um. Die Kosten einer Umbenennung können bis zu sechsstellig sein, aber es ist unbekannt, ob dadurch mehr Geschlechtergerechtigkeit entstanden ist. Ob Studentinnen nun häufiger ein Studierendenwerk aufsuchen, weil sie zuvor dachten, ein Studentenwerk sei nur für ihre männlichen Kommilitonen? Generell fehlt es an Untersuchungen zu den lebensweltlich relevanten Effekten dieses Neusprechs. Es dominieren Experimente zu den Assoziationen, die Probanden im Labor zu den verschiedenen Bezeichnungen (z. B. »Schüler« vs. »Schülerinnen und Schüler«) haben. Dabei führt das generische Maskulinum regelmäßig dazu, dass weniger an Frauen gedacht wird als bei den sogenannten geschlechtergerechten Bezeichnungen. Ob sich dies in die Lebenswirklichkeit übersetzt, ist allerdings weitgehend unklar. Und selbst wenn dies der Fall wäre, bleibt für mögliche Risiken und Nebenwirkungen nur der Stellenwert einer Randnotiz übrig. In einer Studie mit Grundschulkindern legten die Psychologen Dries Vervecken und Bettina Hannover den Kindern entweder Berufsbezeichnungen im generischen Maskulinum (z. B. »Ingenieure«) oder in der Paarform (»Ingenieurinnen und Ingenieure«) vor (Vervecken & Hannover, 2015). Bei stereotyp männlichen Berufen wie dem des Ingenieurs führte die Paarform dazu, dass Mädchen und Jungen den Beruf gleichermaßen für leichter erlernbar hielten, aber auch dazu, dass ausschließlich Jungen annahmen, weniger in dem Beruf zu verdienen. Ob dies unterm Strich sowohl zu einer größeren Repräsentanz von Frauen in diesen Berufen führt als auch zu einer Beseitigung des Fachkräftemangels steht auf einem anderen Blatt. Schließlich kann der Frauenanteil in einem Beruf auch dadurch erhöht werden, dass sich die heranwachsenden jungen Männer gar nicht erst für ihn interessieren.
Ob man der Sache der Frauen mit einer solchen kollektiven Zwangsneurose einen Gefallen tut, oder ob nicht vielmehr die Mehrzahl der Bevölkerung, der der Nutzen all der verordneten Umständlichkeiten ja einleuchten müsste, in eine kontraproduktive Trotzhaltung getrieben wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls gibt die Kurzsichtigkeit in der Argumentation zu denken. So haben es die Verfasser dieser Reglementierungen anfangs nicht für bedenkenswert gehalten, dass es Sprachen gibt, wie beispielsweise die türkische oder ungarische, in denen überhaupt keine geschlechtlichen Markierungen vorgesehen sind. Wenigstens ein bisschen weniger krass sollten in solchen Kulturen doch also die Rollenunterschiede der Geschlechter ausfallen, wenn die Sprache wirklich mit so überragender Kraft den Stil des Verhaltens und Erlebens prägt. Gleichwohl wird niemand behaupten wollen, dass türkische Männer aufgrund früh eingeübter Sprechgewohnheiten weniger Macho-Allüren zeigen und bereitwilliger Windeln wechseln als ihre deutschen oder italienischen – im diskriminierenden Milieu indogermanischer Grammatik aufgewachsenen – Geschlechtsgenossen.
Als diese Problematik dann nicht mehr zu ignorieren war, ging man der Sache dankenswerterweise auf den Grund. Prewitt-Freilino und Mitarbeiter legten auf der Basis eines beachtlich umfangreichen Materials eine vergleichend-linguistische Studie vor, die dieser Frage nachging (Prewitt-Freilino et al., 2012).
Zu ihrer Enttäuschung fanden sie keinen signifikanten Unterschied in Sachen Geschlechtergerechtigkeit zwischen Ländern mit einer Sprache ohne jegliche geschlechtliche Markierung und Ländern, in deren Sprache, wie im Deutschen, Nomina und Personalpronomina nach Geschlecht unterschiedlich markiert sind. Hierfür musste natürlich eine Erklärung gefunden werden, und da verfiel man auf die Annahme, selbst in Sprachen ohne geschlechtliche Klassifikation könne es ja Worte geben, die auch, ohne dass man es ihnen ansieht, eine unbewusst verzerrte, auf Männer zentrierte Interpretation hervorriefen. Dass damit die Grundthese, die Grammatik selbst würde der Diskriminierung Vorschub leisten, zu Grabe getragen wird, scheint niemandem aufgefallen zu sein.
Zum Glück brachte die Untersuchung dann doch noch ein wenigstens halbwegs verwertbares Ergebnis. Es gibt Sprachen wie das Englische, die zwar ihre Nomina nicht geschlechtlich klassifizieren (»the« als einziger bestimmter Artikel), aber geschlechtsspezifische Pronomina besitzen (»he/she/it«). Länder, in denen diese Art von Sprache vorherrscht, weisen eine vergleichsweise höhere Geschlechtergerechtigkeit besonders in wirtschaftlicher Hinsicht auf. Das war nun auch wieder nicht so leicht zu erklären. Die Lösung, die den Autoren schließlich einfiel, hat ein genialisches Flair: Die geschlechtsneutral konstruierten Nomina könnten hier von sich aus keinen Schaden anrichten. Und die flexibel einsetzbaren Personalpronomina erleichterten dann ohne große Umstände eine sprachliche Inklusion von Frauen.
Man erkennt an diesem Beispiel, wie unerlässlich es ist, bei der Interpretation empirischer Befunde ein Mindestmaß an selbstkritischer Zurückhaltung zu wahren.
2 Tuider, 2015 »LESBISCH-SCHWUL-BI-Trans* Sexuelle Vielfalt und sexuelle Vorurteile in der Jugendhilfe« am 23.11.2015 im Historischen Ratssaal der Stadt Münster
3 Eine fundierte und kritische Einführung in die theoretische und empirische Befundlage zu dieser Thematik gibt Klann-Delius, 2005.