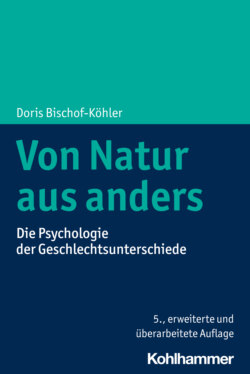Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.5 »Natur und Freiheit sind Gegensätze«
ОглавлениеWas würde es bedeuten, wenn bei geschlechtstypischem Verhalten und Erleben tatsächlich Anlageunterschiede eine Rolle spielten? Wir werden uns dieser Frage nicht sogleich zuwenden, sondern zunächst die sozialisatorischen und kulturellen Einflussfaktoren betrachten und ausloten, wieweit sich empirisch belegbare Unterschiede durch sie erklären lassen. Einige Worte der Klarstellung sind aber vorab am Platze, damit Leser und Leserinnen sich eine Vorstellung vom Stellenwert machen können, der dem Faktor Biologie in späteren Kapiteln zuzumessen sein wird. In Stichworte gefasst lässt sich der zu entwickelnde Standpunkt wie folgt skizzieren.
Die Relevanz der Veranlagung beschränkt sich nicht darauf, die morphologische Geschlechtlichkeit vorzugeben, die wir dann reflektieren und zum Kristallisationskern erzieherischer Wertmaßstäbe und persönlicher Identitätsbildung machen. Dabei soll keineswegs abgestritten werden, dass diesem Prozess eine wichtige Bedeutung zukommt. Bei Sichtung des vorliegenden Befundmaterials scheint es aber wohl unabweislich, dass sich auch die psychologischen Dispositionen der Geschlechter voneinander unterscheiden, noch bevor wir darüber nachdenken oder an ihnen herumerziehen, dass also Frauen und Männer von vornherein in ihren Interessen und Motiven, im Stil ihrer Emotionalität und – was noch am unwichtigsten ist – auch auf dem Begabungssektor verschieden angelegt sind.
Das bedeutet nun aber nicht, dass wir durch solche Dispositionen in unserem Verhalten determiniert wären. Die Natur legt uns nicht in dem Sinne fest, dass wir uns nur in einer bestimmten Weise und nicht anders verhalten könnten. Wir sind als Menschen prinzipiell frei, unsere Handlungen zu planen und zwischen Alternativen zu entscheiden. Die Wirkung natürlicher Dispositionen ist appellativer Art; sie legen uns bestimmte Verhaltensweisen näher als andere. Bestimmte Tätigkeiten und Aufgabenbereiche kommen einfach den im Durchschnitt vorherrschenden Neigungen, Interessen und Begabungen des einen Geschlechtes mehr entgegen als denen des anderen, verschaffen jenem daher mehr Befriedigung, lassen sich bequemer realisieren und tragen besser zum Gefühl der Erfüllung bei.
Es geht also gar nicht darum, dass das eine Geschlecht nicht Äquivalentes in den Bereichen, die eher dem anderen liegen, vollbringen könnte. Einige Naturtalente für noch so »typisch männliche« oder »weibliche« Kompetenzen gibt es immer auch beim Gegengeschlecht, und auch bei den übrigen ließe sich mit geeigneten Erziehungsmaßnahmen eine Angleichung der Leistungen erreichen; zumindest theoretisch wäre sogar so etwas wie eine Rollenumkehr denkbar. Nur müsste diese eben eigens trainiert werden, man müsste bestimmte Tätigkeiten einüben, sich mehr anstrengen und unter Umständen stets erneut gegen innere Widerstände ankämpfen. Auch wenn die Natur nichts erzwingt, so fordert sie doch ihren Preis.
So wird sich – um ein geschlechtsneutrales Beispiel heranzuziehen – ein Junge von körperlich eher zarter Konstitution schwerer tun, bestimmte Turnübungen perfekt auszuführen, als sein Klassenkamerad mit athletischem Körperbau. Aber bekanntlich kann man durch Krafttraining viel erreichen, nur ist es eben zeitaufwendig und bedarf der besonderen Motivierung. Beide Schüler können also zur gleichen Leistung kommen, nur fällt sie dem einen eher mühelos zu, während der andere sich anstrengen muss. Fest steht allerdings, dass der Turnlehrer bestimmt keinen Erfolg mit dem körperlich schwächeren Jungen hätte, wenn er beide konsequent »gleich behandeln«, beiden also von Anfang an das Gleiche zumuten würde. Er muss seine Förderung vielmehr individuell an die Voraussetzungen seiner einzelnen Schüler anpassen. Dies ist auch schon das Geheimnis, wie man sich generell den Umgang mit unterschiedlichen Veranlagungen zu denken hat: Um das gleiche Verhaltensergebnis zu erreichen, muss man das erzieherische Vorgehen in Anpassung an das jeweilige Entwicklungspotential differenzieren.
Nun kommt noch ein Weiteres hinzu. Geschlechtsrollenerwartungen tendieren wie alle Stereotype dazu, über einen Kamm zu scheren; sie tun so, als seien alle Männer in gleichem Maße anders als alle Frauen. In Wirklichkeit gibt es aber Abstufungen in der Leichtigkeit, mit der das einzelne Individuum ein bestimmtes geschlechtstypisches Verhalten zu verkörpern vermag – bis hin zu einer Minorität, der in der Tat die Rolle des Gegengeschlechts besser liegen würde. Wenn man also Männer und Frauen einzeln befragt, dann nehmen sie Merkmale, die im statistischen Mittel größerer Populationen als geschlechtsdifferenzierend ausgewiesen sind, für sich selbst mit vollem Recht als mehr oder weniger bzw. auch überhaupt nicht zutreffend in Anspruch.
Das simple Schwarz-Weiß-Muster der Geschlechterrollen, dem wir im Alltag immer wieder ausgeliefert sind, ist also wirklich ein primär kultureller Effekt. Nur ist es bei aller Übertreibung nicht ganz willkürlich. Denn die meisten Gesellschaften dürften bevorzugt diejenigen Verhaltensmuster zu Kristallisationskernen ihrer Stereotypbildung machen, die den natürlichen Dispositionen der Mehrzahl ihrer Mitglieder am bequemsten entgegenkommen; das minimiert automatisch den kollektiven Widerstand und garantiert Stabilität. Auf dieser Basis stellt sich dann fast schon spontan eine geschlechtstypische Differenzierung ein, ohne dass der Erziehungsaufwand besonders nachdrücklich in die entsprechende Richtung zu wirken braucht. Die »scharfsinnige und kulturell vielfach bestätigte Wahrheit« der Stereotype, auf die Jeanne Block in ihrem Einwand zu Maccoby und Jacklin aufmerksam macht, beruht wohl letzten Endes darauf, dass die Kultur nachzeichnet und akzentuiert, was die Natur vorgibt.
Abb. 3.2: Gesellschaftliche Transformation einer überlappenden empirischen Verteilung geschlechtstypischer Verhaltensmerkmale (oben); Akzentuierung der gelebten Unterschiede durch normative Dichotomie der Rollen (Mitte); Höherbewertung der männlichen Abwertung der weiblichen Verhaltensmuster (unten)
Abbildung 3.2 drückt das Gemeinte schematisch aus ( Abb. 3.2): Die gesellschaftliche Selbstinterpretation des Menschen ist der Schlichtheit des Gruppendenkens angepasst, drängt daher auf Eindeutigkeit und transformiert ein empirisches »Mehr-oder-Weniger« leicht in ein normatives »Alles-oder-Nichts«. Wo sich also ein Merkmal nur statistisch eher bei Männern oder bei Frauen häuft, wird es rasch zur gesellschaftlich einklagbaren Norm, so dass die Verteilung im Endergebnis viel eindeutiger ausfällt, als der natürlichen Veranlagung entspräche. Wobei gerade der Umstand, dass es eine solche Veranlagung gibt, erst den Stress jener verständlich macht, die von Natur aus am »falschen« Ende ihrer Verteilungskurve siedeln, ein Problem, auf das wir im Zusammenhang mit dem »dritten Geschlecht« noch genauer zu sprechen kommen.