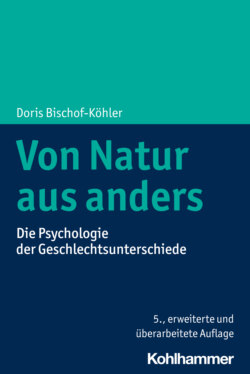Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.5 Feministische Alternativen
ОглавлениеDer unverblümt diskriminierende Unterton der Theorie Freuds, bei dem sich zu seinen Lebzeiten kaum jemand etwas dachte, hat später zunehmend Anstoß erregt und dazu geführt, dass einige von Freuds Schülern und vor allem Schülerinnen Vorstellungen entwickelten, die explizit frauenfreundlicher ausfielen und dafür im Gegenzug das männliche Geschlecht problematisierten.
Am bekanntesten unter diesen ist Nancy Chodorow geworden (Chodorow, 1978). Für sie stellt sich das Bild etwa wie folgt dar: Auch hier, darin gleicht ihr Ansatz dem Freuds, bildet die Mutter als natürliche Quelle von Nahrung und Geborgenheit das primäre Bindungsobjekt für Kinder beiderlei Geschlechts. Beide unterscheiden sich daher auch zunächst nicht im Stil des Verhaltens und Erlebens – sie suchen gleichermaßen Bindung, Verschmelzung, emotionale Wärme. Alsbald beginnt jedoch die Mutter, den anatomischen Unterschied zwischen Sohn und Tochter zum Angelpunkt diskriminativen Verhaltens zu machen: Sie erlaubt der Tochter, die ihr als Erweiterung ihres eigenen Selbst erscheint, weiterhin an der Mutter-Kind-Symbiose zu partizipieren, während sie den Sohn mehr und mehr als andersartig erlebt und ihn dies auch spüren lässt. Mit dieser Deprivation kann der arme Kerl nur dadurch fertig werden, dass er hart wird, sich fortan seinen Gemütsbedürfnissen verschließt und jede empathische Anwandlung unterdrückt, da ihn diese ja nur wieder dazu verführen würde, sich jene emotionale Verschmelzung zu erhoffen, die ihm von der Mutter verwehrt bleibt.
Die Töchter hingegen haben dieses Problem nicht; sie können im warmen Nährboden emotionaler Geborgenheit reifen und gedeihen. Sie »definieren sich […] nicht im selben Maße wie Jungen durch Verleugnung präödipaler Beziehungsmuster. Regression zu diesen Mustern wird von ihnen demnach nicht als so grundlegende Bedrohung ihres Ichs erlebt« (Chodorow, 1978, S. 167, übersetzt von der Autorin). Zu ihrer Geschlechtsidentität gehören also weder Loslösung noch Individuation, sie haben beide gewissermaßen nicht nötig und ersparen sich damit auch die ständigen Beziehungsprobleme, mit denen Männer ihre aufgezwungene Ich-Abgrenzung bezahlen müssen.
Das könnte so verstanden werden, als seien Männer im Leben zwar unglücklich und psychisch verkrüppelt, aber immerhin wenigstens reif, während Frauen das Los seliger Infantilität in Zweieinigkeit mit der Mutter beschieden wäre. Damit ist Chodorow aber nicht einverstanden. Wenn in unserer Gesellschaft Persönlichkeitsentwicklung mit Ablösung gleichgesetzt werde, so sei dies bereits die Auswirkung der von Männern beanspruchten Richtlinienkompetenz, die einfach einseitig ihren eigenen Lebensstil als verbindlich deklarierten und die weibliche Mentalität daran mäßen. Im Übrigen bleibt der Autorin nicht verborgen, dass Mädchen auch Konflikte mit ihrer Mutter haben und sich vom Vater fasziniert zeigen. Letzteres deutet sie als Reaktion auf den Umstand, dass der Vater sich ihren Kontaktwünschen so oft durch Abwesenheit entziehe. Spannungen mit der Mutter wiederum erklärten sich dadurch, dass dieser in der frühen Kindheit so uneingeschränkte Allmacht zukam.
Verglichen mit dem Ansatz Freuds zeichnet Chodorow sicher ein deutlich anderes Bild der affektdynamischen Prozesse. Davon abgesehen treten aber unverkennbare Gemeinsamkeiten beider Theorien hervor: Beide postulieren eine ursprünglich gleiche Erlebnisweise von Jungen und Mädchen, in beiden Fällen fungiert die Mutter als primärer Bindungspartner, der anatomische Geschlechtsunterschied wird hier wie dort zum Auslöser der Diskrimination, und in beiden Fällen ermöglicht bzw. erzwingt ein Elternteil – bei Freud der Vater, bei Chodorow die Mutter – durch die Art, wie es mit dem Kind interagiert, die geschlechtliche Identifikation (Chodorow, 1978, S. 167).
Kritisch einzuwenden ist auch gegen Chodorow, wie schon gegen Freud, dass die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil eine größere Ähnlichkeit des Charakters zwischen Müttern und Töchtern einerseits und Vätern und Söhnen andererseits bedingen müsste, für die es keine empirischen Belege gibt. Was die starke Betonung der positiven Beziehung zwischen Mutter und Tochter und den Ausschluss des Sohnes betrifft, so geben hierzu insbesondere Befunde der Bindungstheorie zu denken. Diese unterscheidet – je nach Qualität der Mutter-Kind-Beziehung – »sicher« und »unsicher gebundene« Kinder, wobei die unsichere Bindung dadurch bedingt ist, dass die Mütter Probleme haben, emotionale Nähe zu ihren Kindern herzustellen. Während sicher Gebundene sozial kompetent sind und affektiv einen guten Rapport herstellen können, gelten unsicher Gebundene als emotional eher problemgeladen und neigen dazu, sich zurückzuziehen (Ainsworth et al., 1978; Bretherton, 1985). Wenn Chodorow Recht hätte, dann müssten Jungen in erster Linie in der zweiten Gruppe zu suchen sein. In den zahlreichen Untersuchungen, die in der ganzen Welt zur Bestimmung des Bindungstyps an kleinen Kindern vorgenommen wurden, findet sich aber kein Hinweis für die Überrepräsentation des männlichen Geschlechts bei unsicher Gebundenen (vgl. auch Maccoby, 2000).