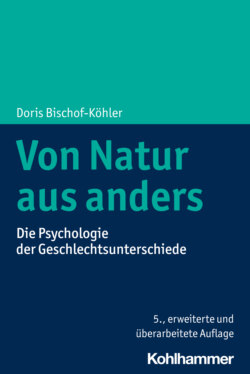Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 54
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5.10 Kriterien für die Modellwahl
ОглавлениеEin zweites Problem, das sich bei der Nachahmung stellt, ist die Frage, welche Eigenschaften eine Person eigentlich aufweisen muss, um sich als Modell zu qualifizieren.
In diesem Zusammenhang hat das Konzept der Identifikation auch in die soziale Lerntheorie Eingang gefunden, in der sie mit Imitation gleichgesetzt wird. So spricht Bandura, der Exponent der sozialen Lerntheorie, direkt von »identifikatorischem« Lernen (Bandura, 1977) und eine zentrale Frage ist auch hier, warum man sich jemanden Bestimmtes aussucht, um sich mit ihm zu identifizieren.
In der Theoriebildung zur Modellwahl werden Fürsorglichkeit, Status und Macht als wichtigste Kriterien für die Identifikation benannt. Bei der Festlegung gerade dieser Eigenschaften haben, wie sich zeigen lässt, wiederum psychoanalytische Überlegungen Pate gestanden.
So klingt beim Stichwort Fürsorglichkeit das Konzept der anaklitischen Identifikation an, das von Sears geprägt wurde, einem lerntheoretisch orientierten Forscher, der ursprünglich Anhänger der Psychoanalyse war (Sears et al., 1966). Anaklitisch heißt soviel wie »anlehnend«, »Halt suchend«; die so bezeichnete Identifikation wird als Reaktion darauf verstanden, dass die Mutter sich nicht ununterbrochen um das Kind kümmern kann. Das Kind erlebt die daraus resultierende Unterversorgung an Zuwendung als bedrohlich und fühlt sich verlassen. Indem es sich nun mit der Mutter identifiziert, so meint Sears, imitiert es sie, übernimmt also gleichsam stellvertretend die Pflegerolle an sich selbst. Dadurch kann es den drohenden Verlust besser aushalten. Ob diese Theorie zutrifft, muss offenbleiben, es sei nur angemerkt, dass es wenig funktional wäre, wenn die Mutter auf diese Weise überflüssig würde.
Gemäß der »Status-Neid«-Theorie wird derjenige bevorzugt nachgeahmt, der sich in einer kompetitiven Situation als der Sieger erweist. Die Theorie lässt eine Verwandtschaft mit der psychoanalytischen Konzeption einer » Identifizierung mit dem Angreifer« erkennen, wie sie aus der ödipalen Situation resultieren soll. Wie in Kapitel 4.1 dargestellt, muss das Kind zur Kenntnis nehmen, dass der Vater bei der Konkurrenz um die Mutter als Sieger hervorgeht ( Kap. 4.1). Der psychoanalytischen Theorie folgend übernimmt der Junge die befürchtete Strafe des Vaters in Form eines schlechten Gewissens, und indem er dies tut, identifiziert er sich mit ihm.
Die beobachtete Ausübung von Macht als Motiv der Modellwahl unterscheidet sich nur in einer etwas anderen Akzentgebung von der »Status-Neid«-Theorie. Es geht letztlich bei beiden darum, dass eine Person als Modell attraktiv wird, weil sie erfolgreich über begehrte Ressourcen verfügen kann.
Mit diesen Kriterien stellt sich nun aber für die Geschlechtsrollenübernahme das Problem, wie ein Kind dazukommt, sich ganz speziell für den gleichgeschlechtlichen Elternteil zu entscheiden. Fürsorglichkeit, Status und Macht zeichnen beide Eltern aus, wenn vielleicht auch in etwas unterschiedlicher Akzentuierung. Sie wären somit zwar ideale Vorbilder für ihre Kinder, aber unabhängig von dessen Geschlecht. Die Frage nach der gleichgeschlechtlichen Orientierung bei der Modellwahl bleibt also offen.
Die Lösung, die Mischel vorschlägt, liegt ganz auf einer Argumentationslinie, der die soziale Lerntheorie bevorzugt folgt, wenn sie erklären will, wie es zu einer Modellwahl kommt. Mischel rekurriert nämlich auf geschlechtstypische Verstärkung: das Kind werde eben nur belohnt, wenn es geschlechtsadäquates Verhalten nachahme. Gegen den Einwand, dass eine solche Verstärkung tatsächlich nur selten erfolge, wird vorgebracht, das Kind hätte inzwischen gelernt, sich selbst zu belohnen. Selbstverstärkung ist ein beliebter Ausweg, wenn Lerntheoretiker bezüglich der Belohnung in Erklärungsnotstand geraten, wie Merz bereits kritisch angemerkt hat: Man beobachte, dass nachgeahmt wird, gehe ferner davon aus, dass dies nur aufgrund von Belohnung der Fall sein könne, und sofern sich eine solche nicht nachweisen lasse, verlege man sie ins Innere des Nachahmenden, wo sie sich der Nachweisbarkeit entziehe (Merz, 1979).
Ein anderer, ebenso wenig befriedigender Lösungsvorschlag postuliert, der gleichgeschlechtliche Elternteil sei jeweils in höherem Maße verfügbar. Nun sehen manche Kulturen zwar eine frühe Trennung der Geschlechter vor und leisten da mit der gleichgeschlechtlichen Orientierung Vorschub. In unserem Kulturkreis, in dem Kleinkinder vorwiegend der Mutter oder anderen weiblichen Pflegepersonen anvertraut sind, während Väter eine untergeordnete Rolle in der Betreuung spielen, hat diese Hypothese aber kaum Erklärungswert.
Dieses Problem sah man auch im lerntheoretischen Lager und modifizierte deshalb die Annahme dahingehend, alle Kinder wären unabhängig vom Geschlecht erst einmal eher weiblich identifiziert, Jungen müssten dann um die Schulzeit herum aber durch verstärkte Wirksamkeit männlicher Vorbilder umgepolt werden. Nun spricht aber nichts dafür, dass männliche Bezugspersonen in diesem Altersabschnitt plötzlich ein erhöhtes Interesse und insbesondere die Zeit für eine ausgiebigere Beschäftigung mit kleinen Jungen aufbringen. Die bisher besprochenen Befunde legen auch keineswegs nahe, dass zuerst einmal eine Feminisierung stattfindet. Es sieht vielmehr im Gegenteil so aus, als wären Jungen sogar früher und stärker am eigenen Geschlecht orientiert als Mädchen und das trotz der Tendenz der weiblichen Bezugspersonen sowie des Kindergartenpersonals, bei ihnen vorwiegend neutrales und mädchenhaftes Verhalten zu verstärken.
Als letzte Erklärungsmöglichkeit für die adäquate Modellwahl wird die vom Beobachter wahrgenommene Ähnlichkeit mit dem Modell diskutiert. Das Kind würde bevorzugt diejenigen nachahmen, denen es sich am ähnlichsten fühle, innerhalb der Familie somit den gleichgeschlechtlichen Elternteil. Eine solche Erklärung steht und fällt mit der Frage, ab wann ein Kind überhaupt in der Lage ist, eine solche Ähnlichkeit festzustellen und aufgrund welcher Merkmale. Das Verhalten der Erwachsenen unterscheidet sich ohnehin erheblich von dem der Kinder, ganz unabhängig davon, ob sie dem gleichen oder dem Gegengeschlecht angehören. Ohne Zweifel handelt es sich bei der Feststellung von Ähnlichkeit also um eine anspruchsvolle kognitive Leistung, bei der man als Minimalforderung erwarten würde, dass ein Kind das Geschlecht bei anderen und bei sich selbst richtig zuordnet. Diese Fähigkeit wird uns im nächsten Kapitel eingehend beschäftigen, es sei aber vorweggenommen, dass sie später einsetzt als die zu beobachtenden Verhaltensunterschiede. Allerdings werden wir auch die Möglichkeit zu diskutieren haben, ob sich Ähnlichkeit nicht auf eine viel elementarere Weise feststellen lässt, ohne dass man das Geschlecht des anderen bewusst zu erkennen braucht.