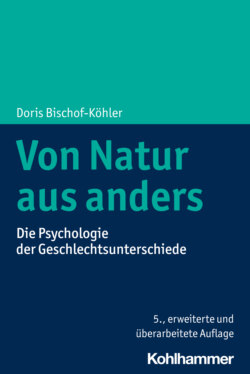Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 63
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6.8 Entwicklungsfolge
ОглавлениеAuf der Basis von Kohlbergs Überlegungen sind inzwischen eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt worden, die es ermöglichen, die Entwicklungsabfolge der einzelnen Stadien bis zur vollkommenen Geschlechtskonstanz genau zu bestimmen (Slaby & Frey, 1975).
Die folgende Tabelle fasst die Entwicklungsabfolge zusammen, so wie sie von Slaby und Frey eruiert wurde. Gemäß einem Übersichtsreferat von Fagot und Leinbach ist der Altersspielraum, in dem das Geschlecht erstmals richtig benannt werden kann, etwas früher anzusetzen und beginnt schon mit zwei Jahren (Fagot & Leinbach, 1993). Zu den abweichenden Altersangaben in einzelnen Untersuchungen kommt es wahrscheinlich wegen methodischer Besonderheiten und den Maßstäben, die man anlegt, um einem Kind Konstanz zuzuschreiben (Szkrybalo & Ruble, 1999).
Slaby und Frey behaupten, dass die in der Tabelle angegebenen Stufen von allen Kindern in der gleichen Reihenfolge durchlaufen werden. Sie berichten zwar erhebliche Altersvariationen, die nächstfolgende Leistung wird aber immer nur erbracht, wenn die vorhergehende auch tatsächlich gemeistert wurde. In unserer eigenen Untersuchung zeigten einige wenige Kinder die Konsistenz vor der Permanenz, meist traten beide Fähigkeiten gemeinsam auf (Zmyj & Bischof-Köhler, 2015; Bischof-Köhler, 2011). Dabei ergab sich ein interessanter Zusammenhang zur Ausbildung des Zeitverständnisses, das im vierten Lebensjahr mit dem Einsetzen der Theory of Mind korreliert und für die Kinder überhaupt erst den Zeitraum eröffnet, in dem sie sich selbst zu anderen Zeitpunkten, also insbesondere auch als Erwachsene, vorstellen können. In jedem Fall kann man davon ausgehen, dass die
Tab. 6.2: Entwicklungsfolge der Geschlechtskonstanz nach Slaby und Frey (1975)
Stadium der GeschlechtskonstanzLeistungAltersspielraumDurchschnittsalter
Geschlechtskonstanz in erster Linie eine Leistung der generellen kognitiven Entwicklung ist und nicht ein Ergebnis ständigen Verbesserns und Belehrens der Eltern. Wäre nämlich Letzteres der Fall, würden wir – entsprechend der je individuellen Lerngeschichte der Kinder – eine viel lockerere Aufeinanderfolge der Stadien beobachten. Der invariante Entwicklungsverlauf bestätigt also eher Kohlbergs Annahme, dass kognitive Verarbeitungsprozesse kraft einer sachimmanenten Entfaltungslogik aufeinander aufbauen.
Kohlberg und andere Vertreter einer kognitivistischen Entwicklungspsychologie betonen, dass wir es hier nicht etwa mit Reifungsvorgängen im »biologischen« Sinn dieses Wortes zu tun haben. Es handle sich vielmehr um einen »aktiven und selbstregulierten Austauschprozess zwischen Organismus und Umwelt« (Trautner, 1991, S. 196). Diese Abgrenzung beruht jedoch auf einem Unverständnis des biologischen Reifungsbegriffs. Wenn der Organismus schon als Interaktionspartner der Umwelt gegenübergestellt wird, dann kann ja nur sein genetisches Programm gemeint sein. Dass sich dieses nur in regulativer Interaktion mit der Umwelt entfalten kann und dabei Schritte, die strukturell auf anderen aufbauen, nicht vor diesen erfolgen können, ist eine schlichte Trivialität, die für alle Reifungsvorgänge gilt ( Kap. 17.2).
Die Befunde sprechen also letztlich dafür, dass bei der Entwicklung der Geschlechtsidentität erzieherische Maßnahmen nur insofern erforderlich sind, als sowohl die Familie als auch das übrige soziale Umfeld eine eindeutige Stellung beziehen müssen, um dem Kind dadurch immer wieder zu vermitteln, zu welchem Geschlecht es gehört. So antwortete eines unserer Versuchskinder auf die mehrmals wiederholte und wohl etwas penetrante Frage, warum denn ein Mädchen, das die Kleider gewechselt hatte, nun ein Junge sei, mit der lapidaren Erklärung: »Die anderen wissen es«. Dadurch, dass die anderen das Kind für einen Jungen halten, wird die Verwandlung zur sozialen Realität, und damit hoffte das durch die Fragen bedrängte Kind, den neugierigen Versuchsleiter endlich zufrieden zu stellen.
Im Übrigen genügt die Alltagserfahrung, um im Kind das Verständnis dafür entstehen zu lassen, dass es zwei verschiedene Geschlechter gibt. Dies drückt sich ja nicht nur in der äußeren Erscheinung und im Verhalten aus, sondern in unserem Sprachraum auch in der Art der Benennung, durch die die Menschen eingeteilt werden in »sie« und »er«, in Onkel und Tante, Vater und Mutter, den Otto, die Lisa. So schwierig es erscheinen mag, von diesen unterschiedlichen Benennungen das Konzept der Zweigeschlechtlichkeit abzuleiten, so wäre es doch falsch, in dieser Komplikation den Grund für das zunächst labile Bewusstsein der Geschlechtsidentität zu sehen. Die Ursache liegt nicht darin, dass relevante Lernvorgänge noch nicht zu einem verlässlichen Abschluss gekommen sind, sondern im generellen Verlauf der kognitiven Entwicklung.