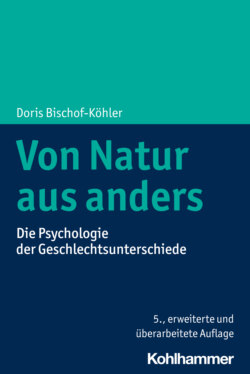Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.7 Toxische Maskulinität
ОглавлениеDas Anliegen, Geschlechtsrollen zu dekonstruieren, war bis vor gar nicht langer Zeit auf das feministische Umfeld beschränkt und richtete sich in erster Linie gegen eine »hegemoniale Männlichkeit«, worunter patriarchalische Strukturen verstanden werden, die als sozial konstruiert gedacht sind und in denen Männer dominieren und Frauen sich unterordnen (Connell, 1999). Somit ist es vor allem »Männlichkeit«, die es zu dekonstruieren gilt. Welch groteske Formen das annehmen kann, dokumentieren gewisse »Anleitungen« zur Jungenpädagogik. So heißt es beispielsweise in einer einschlägigen Veröffentlichung: »Jungen sollen in profeministischer, antisexistischer und patriarchatskritischer Jungenarbeit lernen, dass sie, so wie sie sind, nicht sein sollten und einem fatalen Männlichkeitsbild hinterherjagen« (Forster, 2004, S. 487). In einem anderen Beitrag wird folgende Anweisung gegeben: »Nicht die stabile männliche Identität kann das erste Ziel von Jungen- und Männerarbeit sein. […] Das Ziel ist nicht der ›andere Junge‹, sondern gar kein Junge« (Krabel & Schädler, 2001, S. 36). Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit dieser Anweisungen wird besonders offenkundig, wenn man die Gruppe der Jungen gedanklich durch eine andere diskriminierbare gesellschaftliche Gruppe ersetzt.
Die Behauptung, dass bei Jungen und Männern grundsätzlicher Reformbedarf in Sachen Geschlechtsrollen bestünde, ist in der Gesellschaft mittlerweile kein Nischenthema mehr und findet nicht nur großen Anklang in den Feuilletons, sondern auch im Wissenschaftsbetrieb. Die US-amerikanische Psychologenvereinigung, weltweit Vorbild für andere nationale Psychologenvereinigungen, gab kürzlich einen Ratgeber für Jungen- und Männerarbeit heraus, in dem sie vor einer »traditionellen maskulinen Ideologie« warnte. Diese »beschränke die psychologische Entwicklung von Männern, beeinträchtige ihr Verhalten, führe zu Belastungen und Konflikten und verschlechtere die psychische und körperliche Gesundheit« (APA, 2018, S. 3, Übersetzung von der Autorin). Der Leitfaden beschäftigt sich mit der Frage, wie man in der psychologischen Arbeit Jungen und Männern diese Männlichkeitsideologie ausreden könne und erhofft sich davon eine Reihe von positiven gesundheitlichen Effekten. Bemerkenswert ist, dass diese Empfehlungen hauptsächlich auf Manuskripten beruhen, die entweder keine empirischen Untersuchungen zur Grundlage hatten und damit nur die persönliche Meinung der Autoren widerspiegeln oder die ein korrelatives Studiendesign hatten. Letztere zeigten also nur, dass Gesundheitsprobleme mit einer »traditionellen männlichen Ideologie« einhergingen. Damit ist aber natürlich nicht geklärt, dass die »traditionelle maskuline Ideologie« die Gesundheitsprobleme verursachte. Ursache und Wirkung könnten umgekehrt verknüpft sein oder beide Phänomene könnten durch einen dritten Faktor hervorgerufen werden (s. Kasten »Korrelation und Kausalität«). Experimente zu diesen Spekulationen sind Mangelware. Falls vorhanden, fördern sie eher Petitessen zu Tage, beispielsweise dass Männer, die kurz zuvor maskuline Wörter (z. B. »Schnauzbart«) beiläufig gelesen hatten, vermeintlich ungesündere Lebensmittel (Pommes frites statt Ofenkartoffeln) bevorzugen als Männer, die feminine Wörter (z. B. »Lippenstift«) gelesen hatten. Frauen reagieren übrigens ähnlich (Zhu et al., 2015). Wie aus solchen Experimenten die Gesundheitsgefahr einer »traditionellen maskulinen Ideologie« abgeleitet werden kann, ist unklar. Noch radikalere Strömungen handeln dieses Thema unter dem Begriff »toxische Maskulinität« ab, ohne dass aber gesagt wird, welche Art der Maskulinität nicht toxisch sei und freilich ohne von einer »toxischen Femininität« zu sprechen (Karner, 1996).