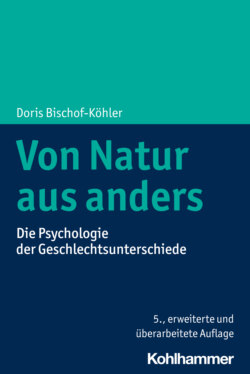Читать книгу Von Natur aus anders - Doris Bischof-Köhler - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 »Geringe Anlageunterschiede sind unbedeutend«
ОглавлениеÄhnlich viel ist von einem zweiten, von der Autorin noch nachgeschobenen Argument zu halten (Hagemann-White, 1984, S. 30, kursiv von der Autorin):
Will die biologische Erklärung sich auf empirische Regelmäßigkeit beziehen, so müssten die gefundenen Unterschiede ausreichend groß sein, um mit der Wirkungsweise biologischer Mechanismen vereinbar zu sein.
Verbunden mit der Behauptung, dass die Unterschiede tatsächlich aber ganz gering seien und sich überhaupt nur zeigen würden, wenn man größere Stichproben heranziehe, wird auch hieraus wiederum die Irrelevanz biologischer Argumentation abgeleitet.
Warum biologische Mechanismen nur für grobschlächtige Unterschiede zwischen den Geschlechtern verantwortlich sein sollen, lässt Hagemann-White offen. Abgesehen davon sind die Differenzen aber gar nicht überall so minimal, wie sie meint. Am ehesten trifft dies für den kognitiven Bereich zu. Der Autorin sind aber offensichtlich die vielen Befunde zur motivationalen, emotionalen und sozialen Entwicklung insbesondere bei Kleinkindern entgangen, auf die wir noch ausführlich zu sprechen kommen und bei denen Schwerpunktverschiebungen zwischen den Geschlechtern durchaus ins Gewicht fallen.
Schon eher ernst zu nehmen ist ein weiteres Argument, das häufig gegen die Biologie ins Feld geführt wird, bei genauerer Analyse allerdings gerade umgekehrt gut geeignet ist, um die Durchschlagskraft auch schwacher biologischer Effekte im Anlage-Umwelt-Wechselspiel verständlich zu machen.
Bei den meisten psychologischen Merkmalen, die statistisch zwischen den Geschlechtern differenzieren, ist es so, dass sich die Verteilungskurven für Frauen und Männer weitgehend überlappen. Die Variation innerhalb eines Geschlechts ist also oft größer als die zwischen Männern und Frauen insgesamt. Daraus wird mit schon vorhersehbarer Regelmäßigkeit abgeleitet, dann könne man die Unterschiede doch gleich ganz ignorieren. Dabei wird ebenso regelmäßig übersehen, dass solche Unterschiede trotz ihrer Geringfügigkeit durchaus schon genügen, um aufgrund spezieller Dynamiken erhebliche Schieflagen zu produzieren. Es gibt keinen Grund, sie von vornherein als belanglos zu bagatellisieren, da die Kultur sie auf jeden Fall »überspielen« könnte.
Die Umwelt unterliegt eben ihren eigenen Sachzwängen, die sie unter Umständen veranlassen können, geringfügige Differenzen nicht zu nivellieren, sondern erheblich zu verstärken. Hierauf haben nachdenkliche Autoren schon seit langem hingewiesen, so z. B. Ferdinand Merz bereits vor über vierzig Jahren in einer noch immer lesenswerten Monographie (Merz, 1979). Anhand eines Gedankenexperiments sei hier vorab schon ein Eindruck vermittelt, wie man sich eine solche Dynamik vorzustellen hat; sie wird uns in diesem Buch noch wiederholt beschäftigen.
In vielen Beschäftigungszweigen sind Frauen erkennbar unterrepräsentiert. Dies trifft insbesondere auf technische Berufe zu. Nehmen wir an, es handle sich um das Fach Maschinenbau an einer Technischen Hochschule. Für die Aufnahme zum Studium bestehe ein Numerus Clausus, der sich nach einer Eignungsprüfung richtet. Gehen wir von dem fiktiven Fall aus, dass die Aufnahme jährlich aufgrund eines Tests an der Gesamtpopulation der männlichen und weiblichen Abiturienten vorgenommen wird, dass sich beide Geschlechter gleichermaßen für das Fach interessieren und dass wirklich nur das Ergebnis dieser Aufnahmeprüfung zählt, also kein Vorurteil gegen Frauen besteht. Nun möge der Eignungstest einige Aufgaben beispielsweise zum räumlich-visuellen Vorstellungsvermögen enthalten, bei denen, aus welchen Gründen auch immer, Frauen im Mittel etwas schlechter abschneiden als Männer. Das schlägt sich in der Statistik der Testergebnisse nieder. Allerdings ist der Unterschied geringfügig. Nehmen wir beispielsweise eine Verteilung an, wie sie in der Abbildung 3.1 veranschaulicht ist ( Abb. 3.1).
Abb. 3.1: Die horizontale Skala zeigt die erreichte Punktzahl im Aufnahmetest, die vertikale den Prozentsatz der Personen, die eine jeweilige Punktzahl erreichen. Die Verteilungen überlappen sich weitgehend, doch liegt der Durchschnitt der Männer aus den genannten Gründen ein paar Punkte über dem der Frauen. Wenn nun wirklich nur Bewerber akzeptiert werden, die mindestens eine bestimmte Punktzahl erreichen, dann wirkt sich der optisch kaum ins Gewicht fallende Unterschied der Verteilungskurven schon gravierend aus. Unter den in der Abbildung zugrunde gelegten Verhältnissen wären unter den erfolgreichen Kandidaten die Männer bereits im Verhältnis 2 zu 1 überrepräsentiert. Bei noch rigoroserer Auswahl wird das Verhältnis sehr rasch noch viel ungünstiger.
Generell muss man sich bei dem Argument, Geschlechtsunterschiede seien wegen der überlappenden Verteilung vernachlässigbar, also immer vor Augen halten, dass in diesen Fällen das in Frage stehende Merkmal nicht nur beim einen Geschlecht häufiger vertreten ist, sondern – was noch wichtiger ist – umso stärker zum Tragen kommt, je weiter man in den Bereich der stärksten Ausprägungen kommt ( Abb. 3.1).