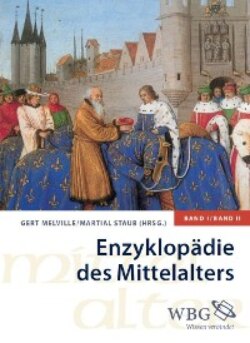Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 25
Konziliarismus
ОглавлениеKirchenversammlungen spielten seit dem 3. Jahrhundert eine wesentliche Rolle bei der Lösung von Konflikten innerhalb der Christenheit [↗ Konzilien und Synoden]. Nach der Konstantinischen Wende traten die Bischofsversammlungen als gesetzgebende Instanz der Kirche auf. Auf ihnen wurden nicht nur dogmatische, sondern auch verwaltungs- und vermögensrechtliche Angelegenheiten geregelt. Besonderes Ansehen genossen die Reichskonzilien, die unter der Schirmherrschaft des Kaisers standen. Der Kaiser berief diese universalen Synoden ein, er bestimmte die Verhandlungspunkte, nahm den Vorsitz ein, erließ die Kanones und beendete die Versammlung. Nachdem das Papsttum an der Wende zum 5. Jahrhundert das universale Kirchenregiment für sich reklamierte [↗ Papsttum und Kirche; ↗ Papsttum, Kurie, Kardinalat], trat es in Konkurrenz zur Autorität der ökumenischen Konzilien. Päpstliche Rechtsentscheide („Dekretalen“) sollten dieselbe Geltung besitzen wie die Konzilskanones. Mit dieser Ansicht konnte sich das Papsttum im Verlauf des Frühmittelalters durchsetzen. Seit dem Reformpapsttum des 11. Jahrhunderts verlagerte sich der Vorrang hin zum Apostolischen Stuhl. Im Dictatus papae (1075) behauptete Gregor VII.: „Keine allgemeine Synode darf ohne den Befehl des Papstes einberufen werden.“
In der beginnenden Rechtswissenschaft der Kanonistik wurde die Doppelspitze der Kirche zum theoretischen Problem. Die Juristen in der Zeit um 1200 stellten sich die Frage, wer in Glaubensfragen höhere Autorität genieße, der Papst oder das ökumenische Konzil. Darüber hinaus beschäftigte sie das Dilemma, wie mit einem häretischen Papst verfahren werden soll und welche Instanz gegebenenfalls über ihn ein Urteil fällen kann. Diese gelehrten Streitfragen wurden mit einer Offenheit diskutiert, die im späteren 13. Jahrhundert nicht mehr vorstellbar war. Seitdem der Papst für sich die Vollgewalt innerhalb der Kirche in Anspruch nahm, wurde der Papst als Souverän in der Kirche angesehen. Doch das Wissen um die Tradition des kollegialen Kirchenregiments ging nicht verloren. Sporadisch bedienten sich Gegner des Papstes aus diesem Reservoir, um den Kampf gegen die überhöhten Machtansprüche der Kurie aufzunehmen. Friedrich II. appellierte nach der durch Innozenz IV. proklamierten Absetzung an ein allgemeines Konzil (1245), die Kardinäle aus der Familie der Colonna (1297) und der französische König Philipp IV. (1303) wiederholten diesen Schritt, um sich der Exkommunikation durch Bonifaz VIII. zu erwehren.
Die Steigerung des päpstlichen Machtanspruchs durch Bonifaz VIII. bewirkte, daß sich die konziliare Tradition erstmals zu einer konziliaren Theorie verfestigte. Der Dominikaner Johannes Quidort († 1306), ein Apologet des französischen Königs, entwarf eine Theorie der Kirchenverfassung, in der das allgemeine Konzil in letzter Instanz über das Regiment des Papstes zu richten hat. Die Rolle des Papstes beschränkte der Dominikaner auf die Leitung der als Korporation gedachten Kirche. Seine Amtsführung sollte der Kontrolle durch das Konzil unterworfen sein. Nach Quidort hat die Kirche also eine Doppelspitze („divided sovereignty“): im regulären Fall den Papst, als letzte Instanz das Konzil. Eine analoge Position vertrat Wilhelm von Ockham, auch wenn er es ablehnte, in Glaubensfragen irgendeiner Institution die letztgültige Entscheidungsgewalt anzuvertrauen. Letzte Instanz im Bereich des Glaubens ist nach Ockham das individuelle Gewissen. Die Theorie einer Doppelspitze der Kirche wurde von Marsilius von Padua dagegen abgelehnt. Für Marsilius repräsentiert das allgemeine Konzil die Gesamtkirche und kann allein gültige Gesetze erlassen. Wie bei Ockham stand auch bei Marsilius der Kampf gegen den Absolutismus des avignonesischen Papsttums im Vordergrund. Beide entwarfen konträre Modelle einer Kirchenverfassung, ohne daß sie konkret an eine Realisierung ihrer Planentwürfe denken konnten.
Nach dem Ausbruch des Großen Abendländischen Schismas im Jahr 1378 plädierten Konrad von Gelnhausen und Heinrich von Langenstein für die Einberufung eines Konzils zur Beilegung des Streits zwischen Urban VI. und Clemens VII. Dieser Lösungsansatz setzte sich jedoch erst durch, als andere Lösungswege (via cessionis und via unionis) gescheitert waren. Auf dem Konzil von Konstanz (1414–1418) erreichte die Debatte um die Kompetenz von Papst und Konzil ihren ersten Höhepunkt. Die Gelehrten griffen sowohl auf die ältere kanonistische Debatte der Zeit um 1200 als auch auf die Schriften Quidorts, Marsilius’ und Ockhams zurück, um konziliaristische Lehren zu formulieren. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Theorie einer zwischen Papst und Konzil geteilten Souveränität weiterhin die Oberhand behielt. Das berühmte Konzilsdekret Haec sancta (1415) war für verschiedene Deutungen offen. Es verkündete, daß das allgemeine Konzil eine von Christus gestiftete Institution sei und gegenüber dem Papst Superiorität in Glaubensfragen, in Fragen des Schismas und der Reform der Kirche an Haupt und Gliedern besitze. Im Jahr 1417 bestimmte das Konzil von Konstanz im Dekret Frequens, daß allgemeine Kirchenversammlungen regelmäßig stattfinden sollen. Auf dieser Grundlage wurde 1431 das Konzil von Basel einberufen. Dort radikalisierte sich der Konziliarismus zu einer kohärenten korporatistischen Doktrin der Kirchenverfassung. In den sogenannten Tres veritates (1439) wurde der Konziliarismus zum Dogma erklärt und stempelte man seine Gegner zu Häretikern. Obwohl das monarchische Papsttum diesen Konflikt im 15. Jahrhundert für sich entscheiden konnte, übte die Debatte über die Lokalisierung von Souveränität großen Einfluß auf die politische Theorie der Neuzeit aus.
KARL UBL