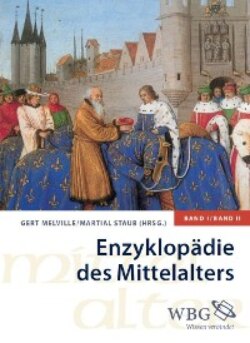Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 36
Städtische Genossenschaften
ОглавлениеObwohl die Stadtkommune [↗ Stadtregiment] nicht die älteste Genossenschaftsform darstellt, genießt sie eine Vorrangstellung in der Geschichte der mittelalterlichen Organisationen. Diese gründet in der Entwicklung der Kommune zu einem Hauptakteur der europäischen Politik neben dem Nationalstaat. Die Lebensdauer der Kommunen und ihre Konkurrenzfähigkeit erklären denn auch, warum sie von den Historikern mit der modernen Gesellschaft in Verbindung gebracht wurden. Diese Betrachtungen heben üblicherweise, wie bereits angedeutet, entweder auf ihre Ablösung durch den Nationalstaat oder ihre Aufhebung in der bürgerlichen Gesellschaft ab. In letzter Instanz wird dabei angenommen, daß die Kommune in der Moderne nicht überlebensfähig war. Dieses Urteil läßt sich indes nur aufrechterhalten, wenn der Nationalstaat als die einzige moderne Form von Staatlichkeit betrachtet wird. Fragen wie die der kommunalen Autonomie oder des Gewaltmonopols haben sich gerade wegen ihrer Orientierung am Vorbild des modernen Staates als wenig brauchbar erwiesen. Die Bedeutung der Kommune in der europäischen Geschichte wird wiederum erst dann sichtbar, wenn Historiker von einer Pluralität von Staatsauffassungen ausgehen. Ein solcher Schritt setzt allerdings voraus, daß die Kommune – wie der Nationalstaat – in eine langfristige Perspektive gerückt wird.
Willkür, Freiheit und Mitbestimmung. Wesentlich für das städtische Recht ist die Willkür bzw. Einung [↗ Stadtrechte]. Sie bezeichnet – W. und F. Ebel zufolge – eine Vereinbarung zu einem bestimmten Verhalten mit der Verpflichtung, für den Fall der Verletzung sich festgesetzten Regeln zu unterwerfen. Wichtig ist dabei, 1. daß es im Streitfall grundsätzlich um die Ansicht der Parteien über ihre streitigen Rechte geht und 2. daß das Urteil keine Strafe im engeren Sinne nach sich zieht, sondern eine selbstgesetzte Sanktion. Solche Urteile zielten darauf ab, die Richtigkeit der im Streitfall aufgestellten Behauptungen zu überprüfen, und sie unterlagen nicht dem Gebot der Verhältnismäßigkeit. Neben hohen „Geldstrafen“ konnten die Stadtverweisung und sogar der Tod durch Hinrichtung auferlegt werden. Damit wird eine erste Charakteristik der Kommune deutlich: nämlich, daß der einzelne die Willkür als Gesamtperson einging und daß die Willkür seinen rechtlichen Status insgesamt veränderte. Er wurde durch einen „Status“-Kontrakt im Sinne von H. Maine und M. Weber zum „Genossen“. Das Sprichwort „Willkür bricht Recht“ verweist auf den Status-Kontrakt, der den Kommunen zugrunde lag. Denn es war dabei deutlich, daß der Kreis der verwillkürten Bürger die Geltungsgrenze der Willkür zeichnete.
Doch es wurde damit noch etwas anderes signalisiert: nämlich, daß die Willkür der Geltungsgrund der Kommunen war. Hier wird eine zweite Charakteristik der Kommune deutlich. Denn die Willkür bezeichnete nicht nur den Status-Kontrakt, der der Kommune zugrunde lag, sondern auch die Kommune selbst. Der enge Zusammenhang zwischen beiden Aspekten wurde im Bürgereid artikuliert, durch den sich der einzelne der Willkür anschloß und ohne den diese die Generationen nicht hätte überdaueren können. Ab dem Augenblick, wo wir ihn erfassen können (d.h. gegen Ende des 11. Jh. in Italien), umfaßte der Bürgereid einerseits den Frieden zwischen den Bürgern (daher der Name pax oder concordia) und andererseits die Wahl der Konsuln und die Unterwerfung der Bürger unter ihre (zeitlich begrenzte) Befehlsgewahl.
Damit wird eine dritte Charakteristik der Kommune angesprochen: Mehr noch als auf die Regeln des Zusammenlebens zielte die Kommune auf die Regeln des Zusammenhandelns. Daraus folgt auch, daß die Kommunen keine echte Trennung zwischen Politik und Gesellschaft kannten.
Gerade diese – aus moderner Sicht – mangelnde Trennung wurde aber als Gewähr für die Freiheit der Kommune angesehen. Wie besonders die Verbannung „straffälliger“ Bürger zeigt, die ab dem 12. Jh. in Italien nachgewiesen ist, wurde die Nicht-Einhaltung gewillkürter Vereinbarungen als Bedrohung für die gesamte „Genossenschaft“ angesehen. Freiheit durch Mitbestimmung – so könnte die vierte und wichtigste Charakteristik der Kommune umschrieben werden. Die Freiheit nahm denn auch eine zentrale Stelle in der politischen Sprache des Kommunalismus bzw. Republikanismus ein. Es ist allerdings auffällig, daß sie getrennt im Zusammenhang mit den beiden Dimensionen der Partizipation thematisiert wurde, indem einerseits auf Fragen des Wohnsitzes, des Eigentums und des Ansehens [↗ Ansehen und Schande] abgehoben und andererseits auf die Gefahr der Korruption verwiesen wurde.
Wohnsitz, Eigentum und Ansehen. Der kommunale Verband ging keineswegs in den Bürgern auf, die innerhalb des Mauerrings wohnten, sondern außerhalb Wohnende konnten ihm beitreten [↗ Städtischer Raum]. Landsässige Adlige begegnen Historikern der italienischen Kommunen zuhauf in den Quellen. Von diesen Bürgern, die außerhalb der Stadt residierten, aber volles Bürgerrecht genossen, sind jedoch jene „Ausbürger“ zu unterscheiden, die wie etwa die Bevölkerung der Landgemeinden im Umkreis der Kommunen zwar ähnliche Verpflichtungen – besonders in steuerlicher Hinsicht – wie die Stadtbürger hatten, dafür aber kaum ähnliche Rechte besaßen. Daß die Kommunen nicht örtlich radiziert sein mußten, wird ebenfalls am Verhalten der zahlreichen Bürger italienischer Städte deutlich [↗ Italischer Raum], die im Exil wohnten. Höchst aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang der Bündnisvertrag von 1208, in dem der podestà von Ferrara, Mantua und Verona, Azzo VI. bzw. Azzolino von Este, die Unterstützung der Stadt Cremona für einen Angriff auf Brescia erhielt, das zuvor zur Mailänder Partei übergetreten war. Dort wird auf die Tatsache hingewiesen, daß Verona Verpflichtungen gegenüber „Rittern aus Brescia“ habe, die, obgleich sie im Exil leben, als die rechtmäßige Kommune von Brescia anzusehen seien. Daß bestimmte Willküren auf Zeit beschlossen wurden, fügt sich ebenfalls in diesen Zusammenhang ein.
Meistens aber war die Willkür von unbeschränkter Dauer. Der Zeitpunkt des Übergangs zur „statuarischen Willkür“ (W. Ebel) ist es, den die narrativen Quellen unter Hinweis auf coniuratio oder pax festgehalten haben, je nachdem ob ihre Autoren die Willkür selbst bzw. die Freiheit des Gemeinwesens, die sie zu gewähren trachtete, oder aber den Friedenszustand im Blick hatten, der als Ausdruck einer funktionierenden Parität unter ihren Mitgliedern angesehen wurde [↗ Genossenschaftliche Ordnungen].
Zwar verlieren sich die Ursprünge der Kommunen im Dunkeln, was Anlaß für kontroverse Theorien war. Bekanntlich leitete H. Pirenne ihre Existenz von den Kaufmannsgilden ab, während A. Vermeesch zumindest in Nordfrankreich einen Zusammenhang mit der Gottesfriedensbewegung [↗ Gottesfriede, Landfriede] sah und S. Reynolds neuerdings darauf hingewiesen hat, daß Gemeinden im Mittelalter eine gängige Form der Vergesellschaftung waren. Der Institutionalisierungsprozeß indes, durch den die europäischen Kommunen gingen, ist gut dokumentiert. In Oberitalien, aber auch in Nordfrankreich und im Rheintal sind Kommunen bereits im 11. Jh. erfaßbar. Im 12. Jh. sind Kommunen sowohl im Nordwesten Europas (Flandern, England) wie auch in Südfrankreich, Mittelitalien und Nordspanien nachgewiesen. Bezeugt sind dabei auch ländliche Kommunen. Im Osten Europas hingegen scheint Novgorod lange Zeit isoliert geblieben zu sein.
Mit der zunehmenden Institutionalisierung der Kommunen wurde es für Stadtbewohner immer schwieriger, sich ihrer Gewalt zu entziehen. Wie G. Dilcher bemerkt, war die Eidesverweigerung kein Verstoß gegen die Bürgerpflichten. Mit anderen Worten: Stadtbewohner mußten ihren Willen kundtun, der Willkür beizutreten, wie unrealistisch auch immer für sie ein Verbleib außerhalb des Bündnisses gewesen sein mochte, der sie als Außenseiter im Friedensbereich der Stadt auswies. Zu bedenken ist dabei indes, daß zahlreiche geistliche Institutionen, die ihre Immunität bewahren konnten, wie die Juden aufgrund des von der Obrigkeit erlassenen Judenrechts und die Unfreien, von den kommunalen Bündnissen ausgeschlossen waren [↗ Juden]. Die allgemeine Tendenz ging allerdings dahin, daß der Unterschied zwischen Willkür und Recht verwischt wurde. „In den Städten wurde“, so W. Ebel, „die Denkform der Willkürung vom ‚rechtsgeschäftlichen‘ Vorgang zur gesetzgeberischen Autonomie“, während der Inhalt der Willkür zur Gewohnheit wurde, die einer stadtherrlichen oder gar landesherrlichen Bestätigung bedurfte. Damit wurden aus geschworenen beschworene Verpflichtungen. Bezeichnenderweise fand auch die willkürliche Sanktion des Stadtverweises in die städtischen Strafbücher Eingang. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang aber auch die stadtherrliche Sanktionierung der Kommunen, sei es durch die Verleihung königlicher oder stadtherrlicher Privilegien oder die Kontrolle der Kommunen über die Ämter der königlichen Verwaltung. So fungierten die beiden Londoner Sheriffs ab 1189 nicht mehr als Vertreter des englischen Königs, sondern sie repräsentierten nunmehr die Stadtgemeinde.
Zu keinem Zeitpunkt sind die Kommunen indes gänzlich in der Willkür aufgegangen. Am deutlichsten wird dieser Punkt bei der Betrachtung der nach wie vor umstrittenen Frage des Anteils des Eigentums an der Fähigkeit der Stadtbewohner, am politischen Leben der Kommune teilzunehmen. Juristisch hat eine solche Bedingung wohl nie bestanden. Die von G. Dilcher angeführten Beispiele für die örtliche Radizierung der italienischen Kommune sind bezeichnenderweise dem Bereich der Gewohnheit, der consuetudo, entnommen. Sie beschreiben jenes (relativ späte) Stadium der Entwicklung der Kommune hin zu einem Rechtsbezirk mit einer obrigkeitlichen Dimension bzw. Legitimität, auf das soeben hingewiesen wurde, und sind daher kaum geeignet, Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen Eigentum und Willkür zu ziehen. Doch ist die Bedeutung des Eigentums in der Partizipation am Gemeinwesen nicht nur eine juristische Angelegenheit. Aufschlußreicher ist womöglich die Frage, inwiefern das Eigentum die Teilnahme am Regiment der Kommunen bedingte.
Der Tendenz nach war ein solcher Zusammenhang sicherlich gegeben. In Italien gewann zwar der sogenannte popolo seit dem 13. Jh. nach der Aufspaltung der alten Oligarchien an politischer Bedeutung. Doch vertrat er vor allem die Interessen der reichen Kaufleute, die ihm zusammen mit der steigenden Zahl der Einwanderer zur Macht verholfen hatten. Selbst nach der Eröffnung der öffentlichen Ämter im Jahre 1343 waren weniger als 5 % der Bevölkerung von Florenz an der Ausübung der Macht beteiligt. In vielen italienischen Städte hatte denn auch der popolo zur Herrschaft eines signore beigetragen. Indes: der Siegeszug der signoria [↗ Fürstentum], die sich zwischen der Herrschaft der Este in Ferrara im frühen 13. Jh. und der endgültigen Rückkehr der Medici in Florenz im frühen 16. Jh. über ganz Nord- und Mittelitalien mit der Ausnahme Venedigs verbreitete, hatte unter anderem seinen Grund in der Formalisierung des Zusammenhangs zwischen Eigentum und Teilnahme am politischen Entscheidungsprozeß zugunsten der sozialen Eliten. Denn die signori und die Stadtoligarchen waren nicht nur durch das Konnubium verbunden. Die politische Privilegierung der Wohlhabenden dürfte sich längerfristig, wie schon Machiavelli wußte, als viel wichtiger als die Verschmelzung der neuen Elite mit den etablierten Familien für die Stabilität der signorie erwiesen haben. Der Klientelismus des Stadtherrn regulierte vielerorts die Partizipation an der Bürgerschaft, während auf der repräsentativen Ebene die Oligarchie die Gunst des signore als Ausdruck ihres Ansehens darstellen konnte. Geradezu paradigmatisch ist in diesem Zusammenhang die Herrschaft Cosimo de’ Medicis über Florenz zwischen der Rückkehr der Familie aus dem Exil im Jahre 1434 und seinem Tod dreißig Jahre später. Cosimo gelang es, durch Klientelismus und Förderung der Kunst die Ehre der Medici mit der Ehre Florenz’ gleichzusetzen. Dadurch war er in der Lage, die Geschicke der Stadt zu bestimmen, ohne ein Amt auszuüben.
Neben der signoria diente gerade im spätmittelalterlichen Reich die Abkömmlichkeit der Mitglieder der Elite sehr oft dazu, die Beschränkung der Teilnahme an der Stadtpolitik auf eine kleine Zahl von Familien zu legitimieren. M. Weber hat bekanntlich die „Abkömmlichkeit“ als das Hauptmerkmal der Honoratiorenherrschaft definiert. In einer Wirtschaft, die überwiegend agrarisch geprägt war [↗ Ländliche Räume] und in der das Kapital letztendlich in Land investiert wurde, reflektierte die Abkömmlichkeit den unterschiedlichen Reichtum. Auch die Kommunen waren auf die Abkömmlichkeit weniger Bürger angewiesen. Dies schloß aber nicht notwendigerweise die Teilnahme aller am Entscheidungsprozeß aus, da die Partizipation weit gefasst war. Anders verhielt es sich dort, wo die Abkömmlichkeit im Zusammenspiel von Suggestion und Erwartung als Grund für zusätzliche Pflichten angesehen wurde. Denn damit ließen sich auch Privilegien für die Elite rechtfertigen. Zahlreiche Bürgerstiftungen des Spätmittelalters weisen auf die Verpflichtungen der Ratsfamilien hin und artikulieren zugleich deren Sonderstatus, wie etwa die Umgehung der Kleiderordnungen [↗ Weltliche Kleidung] durch die Darstellung teurer Stoffe auf den Retabeln oder das Anbringen von Familienwappen [↗ Wappen] auf gestiftete Gegenstände zeigt. Hier wird eine antipartizipatorische Tendenz sichtbar, die in der Reformation vielfach Aufschub erhielt – sowohl im lutherischen als auch im calvinistischen Kontext. Aber auch die republikanische Ideologie ließ ab dem Quattrocento kaum noch die im Trecento noch übliche stoisch-franziskanische Idealisierung der freiwilligen Armut zu. Besonders Guicciardini betonte im 16. Jh. den Anteil des privaten Eigentums an der Teilnahme der Bürger am kommunalen Leben.
Mitbestimmung, Gemeinwohl und Korruption. Seit der Mailänder Pataria-Bewegung im 11. Jh. waren die Kommunen bzw. deren Vorgängerorganisationen darum bemüht, die Korruption einzudämmen. Die Bekämpfung der Korruption zielte dabei nicht auf die Einhaltung der Grenze zwischen privatem und öffentlichem Interesse, sondern im Gegenteil auf ihre Verwischung [↗ Bürgerliche Tugenden und Laster]. War die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Interesse nicht klar gezogen, so bestand nämlich eine gewisse Chance, daß die soziale Differenzierung nicht zum wichtigsten Kriterium der Teilnahme an der Herrschaft wurde. Gebannt werden sollte also die Gefahr, daß nicht alle Bürger an der Herrschaft beteiligt wurden oder genauer: daß die Gruppe derjenigen, die regierten, nicht grundsätzlich mit der Gruppe derjenigen, die regiert wurden, übereinstimmte.
Die Korruption wurde dabei als ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit angesehen. Festzuhalten ist allerdings, daß diese Form der Gleichheit nur wenig mit der Vorstellung einer gerechten Güterverteilung gemeinsam hatte, sondern eher eine Art von politischer Parität bezeichnete. Es sollte sichergestellt werden, daß, wie groß auch immer die Unterschiede zwischen ihnen sein mochten, die einzelnen Bürger in irgendeiner Weise am politischen Entscheidungsprozeß beteiligt waren. Denn nur dadurch wurden Einzelentscheidungen von der gesamten Bürgerschaft getragen. Unter dem Einfluß der Aristotelesrezeption in der Hochscholastik verbreitete sich dafür der Begriff des Gemeinwohls (bonum commune), der seit Thomas von Aquin zwar theologisch überhöht war, indem das Gemeinwohl als Partizipation an Gottes Vollkommenheit angesehen wurde, im allgemeinen jedoch seine praktische Dimension beibehielt. Dieses kam insbesondere in Wilhelm von Ockhams Diktum zum Ausdruck, wonach das Gemeinwohl dem individuellen Wohl grundsätzlich vorzuziehen sei: bonum enim commune preferendum est bono privato.
Die Umsetzung des Gleichheitsgrundsatzes stand also im Mittelpunkt der politischen Machtkämpfe und der politischen Theorie besonders dort, wo sie sich für das kommunale bzw. republikanische Modell interessierte. Ebenso bezeichnend ist die Tatsache, daß die Korruption im Namen der Freiheit und mit dem Hinweis auf die Gefahr der Tyrannei bekämpft wurde. Wurden Entscheidungen als partikular angesehen, drohte Unfrieden. Bei einer Spaltung der Bürgerschaft wuchs die Gefahr, daß die Kommune sich nicht gegen Angriffe von außen verteidigen konnte, womit die Freiheit aller Bürger gefährdet war. Einige Beispiele aus der institutionellen Geschichte der Stadtkommunen einerseits und der Geschichte ihrer Außenbeziehungen andererseits mögen zur Untermauerung dieser Feststellungen angeführt werden.
Wer den Blick allein durch die weite kommunale Landschaft Deutschlands schweifen läßt, stellt eine Vielfalt von unterschiedlichen Formen der Beteiligung der Bürgerschaft am politischen Leben fest, die sich nicht selten sogar im Laufe der Geschichte einer einzelnen Stadt abgelöst haben. Die deutschsprachige Forschung teilt die Regimes in den Reichsstädten, die die Hauptgruppe der Stadtkommunen ausmachten, traditionell in zwei Gruppen auf: die patrizisch und die zünftisch verfaßten Städte. Letzterer Idealtypus wird als eine Reaktion gegen ersteren und seine Realisierung folglich als ein spätes Phänomen angesehen. Als patrizisch wird dabei eine Stadtherrschaft bezeichnet, in der die politischen Ämter von dem auf die städtische Ministerialität folgenden Patriziat monopolisiert wurden. Diese Gruppe „kooptiert[e] durch Konnobium oder Geschlechterschub die aufsteigenden Schichten, vor allem die im Handel aufgewachsenen Fernkaufleute, verhindert[e] damit soziale Spannungen und sichert[e] so ihre eigene Existenz“ (P. Blickle) [↗ Kaufleute, Bankiers und Unternehmer]. In anderen Städten dominierten seit dem 14. Jh. wiederum die Zünfte der Handwerks- und Gewerbezweige [↗ Handwerker]. Zünfte kamen zwar in den meisten Städten vor und waren vielfach sogar darüber hinaus anzutreffen. In zünftisch verfaßten Städten spielten die Zünfte jedoch nicht nur in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht eine wichtige Rolle, sondern sie waren auch politisch das dominante Strukturprinzip. Dies zeichnete sich dadurch aus, daß die Zunftmeister, die die Zünfte nach außen hin vertraten, den Stadtrat bestellten. Dieser wählte als Entscheidungsgremium die Mitglieder der städtischen Organe aus seiner Mitte heraus. Das Patriziat indes war gezwungen, sich als Zunft oder Gesellschaft zu organisieren. Doch waren rein zünftische Verfassungen nur in wenigen Städten wie Colmar, Schlettstadt, Augsburg und Ulm anzutreffen.
Im Regelfall existierten patrizische und zünftische Elemente vielmehr nebeneinander. Selbst eine patrizisch verfaßte Stadt wie Nürnberg ließ Zünfte zu. Es ist allerdings bezeichnend, daß neue Zünfte von der Teilnahme an der Stadtherrschaft ausdrücklich ausgeschlossen waren. Noch aufschlußreicher ist indes, daß diese Politik auch während der kurzen Episode des Zunftregiments von 1348–1349 fortgeführt wurde. Diese unerwartete Kontinuität weist womöglich darauf hin, daß nicht die Identität der Gruppen, die am politischen Leben teilhatten, und schon gar nicht die Leadershipsfrage die entscheidenden Fragen der kommunalen Politik waren. Viel wichtiger war wohl die Anzahl der am politischen Entscheidungsprozeß beteiligten Gruppen.
Das Beispiel der Stadt Worms mag die Kontinuität des kommunalen Regiments jenseits von „Verfassungsänderungen“ dokumentieren. Die Wormser Kommune wurde bereits in Lampert von Hersfelds Annalen im Zusammenhang mit der Zuspitzung des Sachsenaufstandes gegen Heinrich IV. erwähnt. Der junge König habe 1073 Zuflucht in Worms gefunden, wo ihm die Bürger die Treue schworen. Als Anerkennung für ihre Hilfe erhielten die Einwohner, die – so das erste Königsprivileg an eine Stadt im deutschen Reich – gemeinsam gehandelt hatten (communi civium favore), die Befreiung von Abgaben an königliche Zollstätten. Damit war, wie K. Schulz bemerkt, die Stadtgemeinde anerkannt, ohne daß sie als vollorganisierte Institution aufgetreten wäre. In einer Urkunde Friedrichs I. von 1156 wird auf einen vierzigköpfigen Stadtrat hingewiesen, der unter Philipp von Schwaben Urkunden ausstellte, wirtschaftliche Regulierungen erließ und eigenständige politische Entscheidungen traf. Der gewählte Rat (concilium) arbeitete dabei eng mit einem jährlich gewählten Schultheißen (scultetus) zusammen. Im Laufe des 13. Jh. verlor der Schultheiß seine Befugnisse an den Bürgermeister (magister civium). Der Rat hatte die Macht, direkte Steuern von den Bürgern zu erheben und Zölle über importierte und exportierte Waren zu verhängen. Letzteres, das ein königliches Recht war, war durch ein Privileg Friedrichs I. von 1182 bestätigt worden. Als Friedrich II. 1231–32 die Unterstützung der geistlichen und weltlichen Fürsten suchte und dabei die Rechte der Städte einzuschränken versuchte, verfügte er, daß der Wormser Rat aufgelöst und durch ein kleineres Gremium ersetzt wurde. Der neue, fünfzehnköpfige Stadtrat sollte sich aus neun vom Bischof von Worms ernannten Bürgern zusammensetzen (consules), die wiederum sechs Mitglieder kooptieren durften (milites). Wichtig ist dabei aber, daß der Bischof schwören mußte, dass er die Rechte der Bürger fördern werde. Es steht ferner fest, dass die gleichen Familien vor und nach 1232 den Rat bestellten und dass der Rat nach wie vor die Kontrolle über die militärischen Angelegenheiten ausübte. Im 14. Jh. wurde ein aus den Zünften hervorgehender Sechzehner-Ausschuß dem Rat an die Seite gestellt.
Es scheint, als ob Versuche der Einflußnahme durch neue Gruppen auf weiter Front abgelehnt wurden, sofern sie nicht mit den existierenden politischen Akteuren abgesprochen bzw. ausgehandelt worden waren. Schloß sich hingegen ein Teil der Bürgerschaft den Forderungen neuer Gruppen an, drohte die dauerhafte Spaltung der Kommune.
Damit sind wir beim zweiten Beispiel. Einige Parteiführer haben es, wie am Beispiel der signoria gezeigt wurde, zu Alleinherrschern gebracht. Andere wiederum sind als „Tyrannen“ gescheitert. Von Interesse ist dabei, daß der Vorwurf der Tyrannei am Nachweis der Korruption festgemacht wurde. Dieser Zusammenhang wird in einer Reihe von Verfahren gegen führende Kommunalpolitiker in den letzten Jahrzehnten des 15. Jh. im süddeutschen Raum deutlich. Neben dem Zunftbürgermeister Ulrich Schwarz, der 1478 in Augsburg, und dem Bürgermeister Hans Waldmann, der 1489 in Zürich hingerichtet wurde, sei hier an den obersten Losunger Niklas Muffel erinnert, der 1469 in Nürnberg gehenkt wurde.
Muffel soll – so der Wortlaut seiner Verurteilung – das Ratsgeheimnis gebrochen und Geld aus der Staatskasse unterschlagen haben. Beim zweiten Anklagepunkt ging es nicht darum, daß Muffel Geld aus der Losungskammer entwendet hatte, sondern wofür dies geschehen war. Es wurde ihm dabei nachgewiesen, daß er aus Einzelinteresse gehandelt hatte. Was dabei auf dem Spiel stand, wird aber bei genauerer Betrachtung der ersten Urteilsbegründung deutlich. Diese war eine unmißverständliche Anspielung auf Nürnbergs mächtigen Nachbarn, den Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg-Ansbach, zu dem Muffel eine große Nähe nachgesagt wurde. Damit wurde sowohl Muffels selbstherrliches Verhalten angeklagt als auch ein deutlicher Zusammenhang mit der Gefahr hergestellt, der die Unabhängigkeit der Stadt durch sein Verhalten ausgesetzt sein sollte.
Ein weiterer Nachweis für die Tatsache, daß die Kommunen die Freiheit ihrer Bürger durch deren Partizipation am politischen Leben gewährt sahen, wird von den Städtebündnissen erbracht, die von Beginn an die Geschichte der Kommune begleitet haben.
MARTIAL STAUB