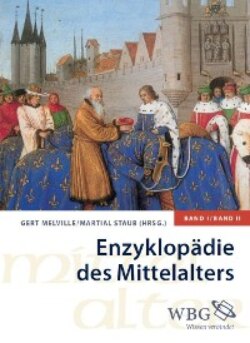Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 26
Organisationsformen
ОглавлениеDie organisationsgeschichtlich dominanteste Formation des Mittelalters war die Kirche. Sie war zwar ein Kind der Antike – sowohl in ihren spirituellen und dogmatischen Fundamenten [↗ Christianisierung des lateinischen Europas; ↗ Bibel] wie auch in ihren rechtlichen Ausformungen [↗ Kirchenrecht]. Doch von dort aus führte sie ihre organisatorischen Prinzipien hinein in das Mittelalter, baute sie aus, verfestigte und differenzierte sie zugleich [↗ Papsttum und Kirche] – gewiß zeitweise bis hin zur Unkenntlichkeit der eigenen Identität sich beugend unter der Konkurrenz einer ebenso sakral verstandenen weltlichen Herrschaft und dennoch nach einer ungewöhnlichen Tradierungsleistung von angeblich primordial festgelegten Maximen emporsteigend im Investiturstreit wie Phönix aus der Asche zu dem erfolgreich durchgesetzten Schlachtruf einer libertas ecclesiae [↗ Investiturstreit], welcher dann während des 13. Jahrhunderts und mit Höhepunkt in der Bulle Unam sanctam die Kirche zur prätentiösen Behauptung führen ließ, ein corpus Christi mysticum mit monopolisierter Heilsvermittlung zu sein.
Die Kirche des Mittelalters war eine organisierte Sozialordnung, eine – in juristischer Begrifflichkeit formuliert – universitas par excellence [↗ Kirchliche Organisationsformen]. Sie gab sich nach kurzen Experimenten mit charismatischen Glaubensverkündern bereits in ihren Anfängen ein strikt hierarchisch durchgeformtes, sich mehr und mehr bürokratisierendes Ämterwesen [↗ Ordination; ↗ Klerus], das nach allmählicher Durchsetzung petrinischer Sukzessionskontinuität im Primat des Bischofs von Rom gipfelte. Sie dogmatisierte früh schon Religiosität zur Konfession, welche strikt bezogen war auf eine rechtlich definierte Mitgliedschaft [↗ Taufe] und welche Schismatiker oder Häretiker auch organisatorisch ausgrenzen ließ [↗ Dogmen und Ketzerei]. Und sie kodifizierte in einer absoluten Pionierleistung schon früh, ab dem 11. Jahrhundert dann in politischer Eigendynamik ihren gesamten Überlieferungsbestand rechtlicher Normierungen [↗ Kirchenrecht], hinter welchem bei aller Flexibilität gegenüber sich wandelnden lebensweltlichen Bedingungen der steinerne Satz Tertullians stand: „Christus hat nicht gesagt: ‚Ich bin die Gewohnheit‘, sondern: ‚Ich bin die Wahrheit.‘“
Von solchen unerschütterlichen Behauptungen waren auch diejenigen Glieder der Kirche nicht ausgenommen, welche glaubten, sich zurückziehen zu können von der Äußerlichkeit der säkularen Kirche hinein in eine Eigenwelt, die bestimmt sein sollte von der Innerlichkeit individueller Begegnungen mit Gott. Es gab diese Menschen immer wieder: von den Wüstenvätern der Spätantike bis hin zu den Eremiten und Wanderpredigern des 11. und 12. Jahrhunderts, denen das kirchliche Establishment ein Leben in privatis locis et proprio jure („an privaten Orten und nach eigenem Recht“) vorwerfen konnte, und einem Poverello, der von Assisi aus jenem „nackten Christus“ des ecce homo nachfolgen wollte als ein nackter, sich in seine Geschöpflichkeit werfender Mensch. Doch auch sie wurden in Regeln gefaßt. Pachomius im 4. Jahrhundert schon hatte an den Nutzen von regelgeleiteten organisatorischen Vereinigungen für Mönche appelliert, weil die meisten von ihnen zu schwach seien, auf sich gestellt den Kampf gegen weltliche Anfechtungen zu bestehen. Benedikt von Nursia z.B. wird es ihm mit fortdauernder Wirkung nachtun und das Kloster als „Werkstatt“ bezeichnen, in der die Chancen auf Perfektionierung ungleich höher lägen als in der offenen, vergleichsweise ungeregelten Welt [↗ Religiosentum – Klöster und Orden].
Die Kirche mit all ihren Zweigen brachte schon in ihrer Frühzeit gewiß die konsistentesten und beständigsten Formen organisatorischer Regelhaftigkeit hervor. An ihrer institutionellen Ausformung gemessen standen andere Ordnungen des Politischen und Sozialen auf hinteren Plätzen.
Das Königtum etwa zog Nutzen aus dem bürokratischen Erbe der Antike nur für eine relativ kurze Zeit [↗ Königtum; ↗ Königsherrschaft]. Bei der Herrschaft eines Theoderich des Großen mag die Dichte des staatlichen Verwaltungsnetzes nicht weiter verwundern. Auf dem Boden Italiens blieb man eine Zeitlang wahrlich noch römisch [↗ Völkerwanderung]. Doch auch seinem großen Gegenspieler Chlodwig, dem Begründer des Frankenreiches, gelang es auf nicht unbeträchtliche Weise, in politisch prekäre Strukturen, die unter anderem geprägt waren von personalen Verflechtungen adeliger Gruppen und persönlichen Bindungen an Gefolgschaftsverpflichtungen gegenüber einem durch die Numinosität des sippengebundenen Geblütsheils legitimierten Königtum, gerade dadurch herrschaftssichernde Stabilisierungsleistungen einzubringen, indem er zum einen die civitates als formale Organisationseinheiten beließ und sie mit bischöflichen Amtsbefugnissen verband und zum anderen seine eigene Kanzlei nach römischen Administrationsmodellen ausgestaltete.
Gleichwohl wird man derartige Anstrengungen, auch weltliche Herrschaft durch verwaltungstechnische Abstraktionen zu stützen, angesichts der rasch darüber hinwegeilenden Schritte der Geschichte als epigonal bezeichnen müssen. Solche, die sich als tatsächlicher Neuanfang qualifizierten, waren wohl erst in der Karolingerzeit [↗ Karolinger] anzutreffen. Es mag sein, daß ein gewichtiger Grund für diese Veränderung bereits in den Implikaten der Thronerhebung des ersten Karolingers lag, die durch die erfolgte Sanktionierung von seiten des Papstes sowie durch Wahl und Salbung den Mangel an Geblütslegitimität insofern ausglich, als das Königtum fortan als ein transpersonales, indes sich in jedem König personifizierendes und ihm damit „zwei Körper“ (E. Kantorowicz) verleihendes Amt zu verstehen war, welches wie eine universitas nicht starb oder auf welches man – wie es der salische Geschichtsschreiber Wipo schon im 11. Jahrhundert tat – das Wort münzen konnte: si rex periit, regnum remansit („Wenn der König stirbt, bleibt das Königtum bestehen“). Tatsache ist, daß in der Hochzeit karolingischen Königtums eine bemerkenswert abstrahierende Rationalisierung der Herrschaftspraktiken stattfand – es sei nur an die das Recht versachlichende Kapitularienge-setzgebung, an die Einrichtung der missi dominici, an das Institut des Königschutzes über Klöster etc. erinnert –, und daß es zudem in Gestalt von neugefaßten und nun verschriftlichten Herrschaftsethiken auch zur Herausbildung ideeller Objektivationen kam, die sogar – wie z.B. durch das Werk Hinkmars von Reims De ordine palatii belegt – eine ausgefeilte Theorie etwa des Organisationsgefüges eines Herrscherhofes zu liefern vermochten.
Tatsache ist aber auch, daß dies alles wiederum nur von kurzer Dauer war und sich daraufhin königliche Machterhaltung für lange Zeit trotz oder vielleicht gerade wegen des nur noch verbleibenden und vermeintlich stabilitätsfördernden Lehenswesens in die auszubalancierenden Verstrickungen persönlicher Beziehungsgeflechte begeben mußte.
Signifikant für diesen Sachverhalt ist der königliche Hof, dessen niedriges Organisationsniveau noch während des Hochmittelalters im Kontrast zur prinzipiellen Nützlichkeit dieser Einrichtung für die Herrschafts- und Verwaltungspraxis – nicht nur der Könige, sondern auch der Fürsten – stand [↗ Höfischer Raum]. Der Engländer Walter Map zum Beispiel bemühte sich in seiner Schrift De nugis curialium vom Ende des 12. Jahrhunderts ernsthaft, das Phänomen „Hof“ zu verstehen, denn der eigene Augenschein half ihm nicht viel weiter: In curia sum, et de curia loquor, et nescio, Deus scit, quit sit curia („Am Hofe bin ich, über den Hof spreche ich und ich weiß nicht, Gott möge es wissen, was der Hof ist“). Ihm erschien ein Hof allein als eine stets wechselnde Menge an Menschen (multitudo) um ein principium – um den König, den Fürsten. Beobachten könne er vorderhand nur, daß die curia – der Hof – der Zeitlichkeit unterworfen sei, daß sie mutabilis et uaria, localis et erratica („wandelbar und vielfältig, örtlich und herumirrend“) sei und daß sie „niemals in gleichem Zustand“ bleibe – numquam in eodem statu permanens. Wenn er vom Hofe weggehe und später zurückkehre, würde er nicht wiederfinden, was er verlassen habe; denn heute sei diese multitudo am Hofe, morgen eine andere. „Stabil“ sei der Hof nur „in seinem fortdauernden Wandel“ – sola sit [ curia] mobilitate stabilis.
Es bedurfte langwieriger komplexer Rationalisierungsprozesse nicht zuletzt auch auf der Ebene der Verwaltung, des Ämterwesens und der Rechtspflege [↗ Rechtsformen], um schließlich das Königtum zu einem dem corpus Christi mysticum analogen Konzept der unvergänglichen corona invisibilis zu führen und vom Spätmittelalter an letztendlich dann doch sehr vehement das Monopol staatlicher Macht einfordern zu können [↗ Herrschaft]. Frühe Vorreiter waren hierbei das französische und das normannische (englische und sizilische) Königtum.
Weiterhin im weltlichen Bereich bleibend wird man indes organisationsgeschichtlich wesentlich fündiger, wenn man einen Sektor betritt, welcher nicht durch jene Formationen monarchischer Herrschaft geprägt war, deren Legitimitätsbehauptungen von vornherein Geltung zugemessen wurde, sondern welcher Vergemeinschaften hervorbrachte, deren Ansprüche auf eigenrechtliche Positionen a priori von usurpatorischer Art waren. Neben dem Mittelalter des hierarchisch Gestuften gibt es ebenso ein Mittelalter des genossenschaftlich Gleichen [↗ Genossenschaftliche Ordnungen]. Gemeint sind näherhin die vielfältigen Formen von Einungen – coniurationes –, deren geschichtsmächtigster Fall neben den Gilden [↗ Gilden und Bruderschaften], Universitäten [↗ Universitäten] und im gewissen Sinne auch den religiösen Orden [↗ Religiosentum – Klöster und Orden] zweifelsohne die Städte waren [↗ Städtische Genossenschaften]. Städte waren prinzipiell zunächst einem Stadtherrn – in vielen Fällen einem Bischof – unterworfen, der sie auf grundherrschaftlicher Basis, also auf der Basis von Unfreiheit, verwalten ließ. Indes kam es schon während des 11. Jahrhunderts im flandrischen Raum und in Norditalien – dort also, wo auch die wirtschaftlichen Pulse Europas jener Zeit schlugen [↗ Handel in den europäischen Regionen] – zu Eidverbrüderungen der städtischen Bevölkerung, mittels deren ein Zusammenschluß grundsätzlich gleichgestellter Genossen erfolgte, um dem Stadtherrn Freiheiten abzutrotzen. Das Bemerkenswerte aber an dieser sozialen Formierung ist nicht nur ihr revolutionärer, Herrschaftshierarchien sprengender Charakter, sondern vielmehr die unmittelbare Konstitutierung einer transpersonalen Struktur; denn nicht die einzelnen Verschworenen traten in einem additiven Miteinander von Individuen handelnd und fordernd auf, sondern die communitas als solche – und diese wurde als eine abstrakte Konstruktion im durchaus intendierten Sinne einer sogenannten juristischen Person verstanden, der die Legisten und Dekretalisten [↗ Jurisprudenz] eben auch die Bezeichnung universitas beigaben. Daß diese städtischen Kommunen dann mit einer kaum für möglich zu haltenden Schnelligkeit eigene und hoch rationalisierte Verwaltungsstrukturen, eigene in ihrer Kompetenz genau umrissene Repräsentationsorgane und Instanzen sowie ein ausgetüfteltes System von Satzungen und Statuten zur höchst differenzierten Regelung aller nur voraussehbarer Verfahrensabläufe schufen [↗ Stadtrechte] – dieses Phänomen mag faktisch an dem Durchsetzungsdruck gegenüber den legitimen Ansprüchen des Stadtherrn gelegen haben. Da man diesem Phänomen aber auch bei den von Fürsten initiierten und damit zumindest legalen Städtegründungen begegnet, läßt es sich strukturell indes wohl eher aus dem Sachverhalt erklären, daß im Unterschied zu monarchisch geführten Sozialsystemen, bei denen der König als eine in sich einheitliche lex animata galt [↗ Königtum], hier sowohl eine Willensbildung durch Entscheidungen aller bzw. gesondert dafür eingerichteteter Repräsentativorgane zustandekommen wie auch eine Sicherung fortdauernder Akzeptanz von einmal getroffenen Entscheidungen bei allen Beteiligten gewährleistet sein mußte – was wiederum Anstrengungen eben um Objektivität und Abstraktion verlangte.
Allen diesen rational organisierten Ordnungen – seien es hierarchische wie die Kirche und die Monarchie oder kollegiale wie die Städte, die Orden, die Universitäten etc. – war gemeinsam, daß man dort namentlich ab dem 12. Jahrhundert mehr und mehr lernte, sich zur inneren Stabilisierung zweier elementarer Instrumente zu bedienen: der Verschriftlichung und der Verrechtlichung. Beide waren unmittelbar aufeinander verwiesen: Nur Schrift [↗ Schriftlichkeit und Mündlichkeit] als ein Raum und Zeit überschreitendes Speichermedium konnte im Alltag von Organisationen einen rechtskonformen Geschäftsgang, eine beweissichernde Kontrolle, eine fortdauernde Dokumentation oder einen Austausch von authentischen Nachrichten gewährleisten. Verrechtlichung aber im Sinne einer Prädominanz gesatzten und dann auch wissenschaftlich reflektierten Rechts [↗ Gesetze, Satzungen] führte zum Phänomen des „definierten Begriffes“, der nicht zuletzt auch wiederum von der Schrift stärker verlangt wurde als vom gesprochenen Wort. Dieser war in seiner Semantik präzisierbar, transformierbar oder gar derogierbar durch differenzierende Interpretationsleistungen, welche sich ebenfalls des Instruments der definierten Begrifflichkeit bedienten. Er war durch das Medium der Schrift auch dorthin transportierbar, wo eine an Körpern gebundene Kommunikation schon längst ihre Grenzen gefunden hätte [↗ Korrespondenz]. So konnten Schrift und Recht in ein neues Verhältnis zueinander treten, dessen Rationalität z.B. der Dominikaner Humbert de Romanis im 13. Jahrhundert mit den lapidaren Worten kennzeichnete: quia de substantia constitutionis est scriptura („weil die Schriftlichkeit von Substanz ist für die Rechtssatzung“). Humbert stand dabei schon ganz auf den Schultern einer Kanonistik und Legistik, die mittlerweile gelernt hatte, hypothetisch-generelle Rechtssätze analytisch zu begreifen [↗ Jurisprudenz]. Vor allem aber eröffnete der „definierte“ Begriff aufgrund seiner hinlänglichen Abstraktheit von situativen Einzelfällen die Möglichkeit zur regelkonformen Subsumption aller Entscheidungsinhalte und damit zur Objektivität des Normativen. Die begrifflichen Abstraktionsleistungen sollten also den grundlegenden Sinn- und Wertevorstellungen von sozialen Ordnungen eine stabile Geltung verschaffen, die unabhängig war von Person und Situation.
Um es auf den Punkt zu bringen: Hier dachte man – wie parallel natürlich auch in den Diskursen der zeitgenössischen Sozialtheorie, der Theologie und der Philosophie [↗ Denkformen und Methoden] – gewissermaßen vom Abstrakten zum Konkreten. Man versuchte, ideelle Werte wie z.B. caritas, pax, iustitia, libertas oder ebenso Kategorien des sozialen Handelns wie z.B. potestas, auctoritas, unanimitas, oboedientia etc. in Definitionen zu fassen und daraus abgeleitete normative Verhaltensstrukturen zu objektivieren. Fortlaufend reformulierte Rechtssatzungen setzten eine derartige Abstraktionsleistung dann textlich für den pragmatischen Gebrauch um. Organisatorische Systeme, die zugleich als Interpretations-, Kontroll- und Verwaltungsinstanzen fungierten und entsprechende Organe und Verfahrensabäufe entwickelten, hatten durchzusetzen, daß sich tatsächlich eine fortgesetzte Realisierung von Handlungsformen gemäß jener normativen Verhaltensstrukturen erwarten ließ. Sehr früh schon wurde dies besonders deutlich in der Carta Caritatis, dem in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts formulierten Basisdokument der Zisterzienser, zum Ausdruck gebracht [↗ Religiosentum; ↗ Religiosenrecht]. Dort findet sich als dauerhafte Aufgabe des Generalkapitels festgeschrieben, „sich mit dem Heil der Seelen zu beschäftigen, in Beobachtung der heiligen Regel und der Ordnung anzuordnen, was zu beseitigen oder zu verstärken sei, und das Gut des Friedens und der Liebe untereinander zu reformieren“ (de salute animarum suarum tract[are], in observatione sanctae regulae vel ordinis, si quid emendandum est vel augendum, ordin[are], bonum pacis et caritatis inter se reform [are]).
GERT MELVILLE