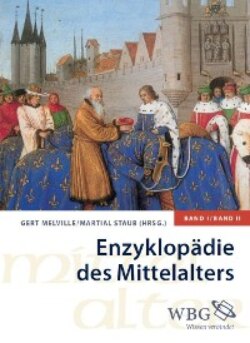Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 49
Männermode, Frauenmode
ОглавлениеBeginnen wir mit dem Augenfälligen. „Kleider machen Leute“, dachte sich im 13. Jahrhundert der Bauernsohn Helmbrecht, legte über sein blondgelocktes Haar eine kunstreich verzierte Kappe mit Papageien, Tauben und Helden aus vergangenen Zeiten und betrat mit seinem bizarren Kopfputz für kurze Zeit eine andere soziale „Welt“. Das aber durfte nicht sein. Schon Karl der Große soll, so will es die „Kaiserchronik“ (12. Jahrhundert) vernommen haben, den Bauern verboten haben, vornehme Kleider zu tragen, ein Indiz neben vielen anderen, wie fragil der „Kleidercode“ grundsätzlich war bzw. ist. Soziale Distinktion ist zweifellos eine wichtige Funktion von Kleidung, aber trotzdem nur eine Funktion neben anderen. Bevor das Kleid Geschichten von gesellschaftlicher Inklusion und Exklusion erzählt [↗ Kleidung, Tracht, Habit], signalisiert es dem Betrachter nämlich, welchem Geschlecht der Träger angehört bzw. anzugehören wünscht (etwa als Tarnung) oder welchem Geschlecht sich der Träger zugehörig fühlt (Transvestiten). Die Konstruktion von Geschlecht benutzt das „Kleid“. Dementsprechend eng sind über die Jahrhunderte hinweg Kleiderdiskurs und Geschlechterordnung miteinander verwoben. Der Begriff „Ordnung“ steht für normative Gesellschaftsentwürfe, die Realität prägen können, Realität aber nie abbilden.
Auf dem berühmten, Ende des 11. Jahrhunderts entstandenen Teppich von Bayeux, der die Eroberung Englands durch die Normannen auf über siebzig Laufmetern Stoff zur Darstellung bringt, scheint „ein Mann“ auf Anhieb „noch ein Mann und eine Frau noch eine Frau“ (Johannes Chrysostomos) zu sein. Aelfgyve, die Tochter Wilhelms des Eroberers, umhüllt ein bodenlanger Mantel; züchtig sind ihre Haare unter einem schulterlangen Schleier verborgen. Männer bzw. Krieger hingegen tragen praktische, knielange Röcke. Doch Mann ist nicht gleich Mann: Die Normannen sind bartlos, der Hinterkopf geschoren, die Haare kurz; Harold und seine angelsächsischen Gefolgsmänner hingegen tragen mittellanges Haar und Oberlippenbärte als Markenzeichen ihrer Männlichkeit. Eine Generation später meinte Wilhelm von Malmesbury, damals, bei der Schlacht von Hastings, hätten die Angelsachsen geglaubt, vor ihnen stünde ein Heer aus lauter Geistlichen. Die Mitte des 11. Jahrhunderts nicht mehr ganz neue „Normannentracht“ – andere sprachen von „Franzosentracht“, noch andere meinten, die Mode käme aus Aquitanien – provozierte manch einen Kirchenmann. „Schamlos“, entrüstete sich Raoul Glaber, „frivol“, heißt es bei Wilhelm von Volpiano, wie Raoul Glaber ein Ordensmann. Dreihundert Jahre später verstand man die Oberlippenbärte in demselben England dann als Besonderheit des irischen Mannes. Einem „loyalen“ englischen Mann standen sie fortan schlecht an.
Ende des 11. Jahrhunderts veränderte sich die Mode. Nunmehr trugen die Männer zu Hofe lange, ausholende, farbenfrohe Gewänder, mit langen Schleppen und überlangen Hängeärmeln, spitze Schnabelschuhe und wieder langes, vorzugsweise blondgelocktes Haar. Kleider wurden fortan auf den Leib geschnitten. Eng schmiegte sich der Stoff an den Körper an. Zahlreich seien die Synonyma für das Schnüren und das Einzwängen der Brust gewesen, kommentiert J. Bumke die neue Modeerscheinung. D. Owen Hughes spricht von einem „transvestitenhaften Angriff“ auf die Manieren einer Kriegerkaste. Die Geistlichen wiederum entrüsteten sich über ihre Geschlechtsgenossen: Das seien keine richtigen Männer mehr. Die neue Mode zeuge von weiblicher Verzärtelung. Die Männer verwandelten sich zu Frauen, schrie Orderic Vitalis auf, abermals ein Kirchenmann; mehr noch, ereiferte er sich weiter, diese Männer glichen Huren.
Bartlosigkeit und blondgekräuseltes Haar galten, wie im übrigen auch wohlgeformte Beine, noch im 14. und 15. Jahrhundert als männliches Schönheitsideal. Daran läßt der tausendfach abgebildete Lieblingsjünger Christi, Johannes der Evangelist, genausowenig zweifeln wie sein literarisches Ebenbild, Chaucers Porträt des blondgelockten Absolon (Miller’s Tale): „Gekräuselt war sein Haar, und glänzend wie Gold; es strebte üppig auseinander wie ein großer, breiter Fächer. Schnurgerade und sauber lag sein schwungvoll gezogener Scheitel. Sein Gesicht zeigte ein frisches Rot, und er hatte gänsegraue Augen. In Schuhen, kunstvoll durchbrochen wie die Fenster von St. Paul und roten Strümpfen schritt er elegant einher. Ganz schlank und schick ging er gekleidet, in einem Rock von hellem Blau, der hübsch und reich mit Schließen besetzt war. Und darüber trug er ein feines Chorhemd, weiß wie die Blüte am Zweig.“
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts änderte sich sowohl die Männer- als auch die Frauenmode radikal. Nachdem Pest, Judenmord und Geißlerzüge ein Ende genommen hatten, kommentiert die „Limburger Chronik“: da hup di wernt [Welt] wider an zu leben unde frolich zu sin, unde machten di menner nuwe kleidunge. Die Röcke seien so eng geworden, daß ihre Träger sich kaum mehr bewegen konnten, und sie endeten weit über dem Knie bzw. kaum eine Handfläche breit unter dem Gürtel. An den Schuhen habe man lange Schnäbel getragen und die Frauen wide heubtfinster, weite Ausschnitte, so daß die Brust fast zur Hälfte bloßlag. Die Forschung spricht von einer „Mode-Revolution“. In einem für mittelalterliche Verhältnisse bislang unbekanntem Maße begann Kleidung sichtbar mit der Geschlechtszugehörigkeit ihrer Träger zu spielen. Fortan wurde gezeigt, was der enge Schnitt ehedem bloß angedeutet hatte. Die Kleider „schrumpften“ an den entscheidenden Stellen: Der Ausschnitt legte die Schultern frei, die ‚, Brüstlein“ drohten aus dem Dekolleté zu rollen. Das durfte nicht sein. Auch die zu kurzen Röcke und Wämse, die den Blick auf den Hosenlatz und die männliche Scham (die geheimen Gemächte) freilegten, verboten um das Gemeinwohl besorgte Stadtväter, meist nachdem ein Seuchenzug oder andere Kalamitäten das Gemeinwesen erschüttert hatten: demnach ist eyn erber rat daran komen, lautet der Ratsbeschluß aus Nürnberg (S. 105f.), das hinfüro eyn ydes mannsspilde, burger oder inwoner dieser statt, seinen latz an den hosen nyt bloss, unbedeckt, offenn oder sichtiglich tragen dürfe. Sittlichkeitserwägungen standen bei den Aufwandsgesetzen des 14. Jahrhunderts noch im Vordergrund. Dazu gehörte auch die Warnung vor den Gefahren, die durch die Auflösung der Geschlechtsunterschiede durch den Tausch von Kleidungsstücken drohten. Manch ein Mandat legt offen, daß die Verbote in erster Linie Jugendliche betrafen. Je jünger der Träger, desto kürzer war der Rock, lehren auch die spätmittelalterlichen Darstellungen der Lebensalter, unter anderem die Miniatur aus dem 1372 für Karl IV. übersetzten Buch über die Eigenschaften der Dinge des Bartholomäus Anglicus. Von gesetzten Ratsherren erwartete man eine ihrer Würde entsprechende Rock- und Mantellänge. Und die begann weit unterhalb des Knies.
Noch im ausgehenden 15. Jahrhundert kämpften die Stadtväter gegen die „schamlose Hosentracht“ der jungen Männer, so Meister, Rat und das Einundzwanziger-Gremium der Stadt Straßburg im Jahr 1493 (Straßburger Zunft- und Polizei-Verordnungen, S. 202): Als sich yetz begit, das ettlich mannes personen, die gots vorcht nit habent, vnerbere, schampere cleyder tragent, die oben tieff vßgeschnytten sient biß vff die schulteren oder vnden so kurtz, das sie jme vornan vnd hinden sin schame nit bedecken mgent mit anderer schentlicher vngestalt, das doch jn erberer personen ougen lesterlich z sehen vnd nit z liden ist. Röcke oder Mäntel, meinte der Magistrat, müßten dergestalt zugeschnitten sein, das die zum mynesten ein halb vierteil ganze fur sin schame vnd oben vff ouch bedecke noch zymlicher gebre. Die Dekolletés hingegen standen im ausgehenden 15. Jahrhundert nicht mehr zur Diskussion. „Goller“ (Umlegekragen), die den Halsausschnitt züchtig bedeckten, hatten das Problem gelöst. Der Stadtrat von Nürnberg erhob das Gollertragen fortan sogar zur Pflicht (S. 96): Auch mögen erber frowen und junckfrowen samattin preyss [lange Frauenkleider] und auch samattine onder anndere seydene goller tragen, doch das dieselben goller allenthalben on goldt, silber und ann der gestycke, wie das genant mag werden, sein sollen.
Bei den meisten frühen Kleiderordnungen, wie bei dem Mandat, das die Stadt Speyer kurz nach dem Erdbeben von 1356 verfaßte, ging es primär darum, Exzesse jeder Art, dazu gehörte auch der Kleiderluxus, einzudämmen. Maßhaltung war das Schlüsselwort, das Thomas von Aquin ein Jahrhundert zuvor in die Diskussion gebracht hatte. Mit der Forderung nach Maßhaltung reagierten die Städte auf äußere und innere Bedrohungen. Standesprivilegien zu bewahren war von zweitrangiger Bedeutung. In diesem wie auch in anderen Fällen sticht indessen die (unter anderem von Thomas von Aquin vorgegebene) asymmetrische Behandlung der Geschlechter ins Auge: Von den 22 in Speyer erlassenen Artikeln beziehen sich zwölf auf Frauen-, nur sieben auf Männerkleider. Den Frauen verboten die Stadtväter sowohl Korsett (engenisse) als auch Männermäntel, zerschnittene Kugelhüte oder Abzeichen in Form von Buchstaben, Vögeln oder ander verleenliche ding mit siden genat. Ähnliches hatten 1322 schon die Stadtväter von Florenz beschlossen. Ferner untersagte der Rat von Speyer 1356 den Bürgerinnen, unangesehen ihrer Person und sozialen Position, Pelzbesatz und Kleiderschmuck aus Gold, Silber, Edelsteinen oder Perlen zu tragen: Unde sollent ouch ire mentel oben zgemaht sin ane [ohne] golt, silber unde berlin mit messigen [maßvollen], niht z witen houbetluchen [Ausschnitt], als von alter ge-wonlichen waz. Auch dafür gibt es zahlreiche norditalienische Vorgänger. Bei den Männern ist wiederum von zu kurzen Röcken, zerschnittenen Kleidern und von Schnabelschuhen die Rede. Standesunterschiede ließen die Speyerer Stadtväter allein auf der Ebene der Akzessoires für Männer gelten, beim Hut- und beim Schuhschmuck: Ez sol ouch dehein man, der niht ist ritter, keinen schch dragen, zerhwen [ausgeschnitten] mit lubern [in Blätterform] oder mit wehen klglichen snytden, wie die snydte sint, die durch hochvart unde niht durch gesuntheit gemaht sint, ane geverde.
Die „Hoffart“ liege im Detail, folgert G. Jaritz aus der frühen Kleidergesetzgebung. Häufig werde gerade das Detail zum prestigefördernden und identitätsstiftenden Phänomen, auf das die Obrigkeit entsprechend reagierte. Ständische Belange bzw. Differenzierungsbestrebungen träten, so Jaritz weiter, gehäuft erst im 15. Jahrhundert in Erscheinung. Im Rahmen dieser neuen „Ordnungen“ spiele dann das Dienstpersonal eine herausragende Rolle. Manch eine Stadt verbot es im 15. Jahrhundert den Mägden, Stoffe und Schmuck ihrer Dienstfrauen zu tragen. 1480 beklagte der Rat von Freiberg, man könne die Frauen nicht mehr von ihren Mägden unterscheiden. Ein schwer zu lösendes Dilemma, bemerkt K. Simon-Muscheid, denn die Rolle, die das Äußere des männlichen und weiblichen Gesindes für das Sozialsprestige und die Ehre eines Hauses gespielt habe, sei nicht zu unterschätzen. D. Owen Hughes bilanziert für die spätmittelalterlichen Städte Norditaliens: „Der schnelle Wechsel der Mode ließ Aussteuern veralten und machte Kleider zu einem weniger dauerhaften Gut, das nicht irgendwann an Töchter weitergereicht, sondern rasch an Mägde verschachert wurde, deren reiche Kleidung dann die soziale Rangordnung durcheinanderbrachte und beißenden Spott auslöste.“
Um das Thema Geschlecht und Kleidung spinnt sich ein dichtes Netz von Sprichwörtern, Traktaten, Predigten, Lehrbüchern und Streitschriften, die sammeln, beschreiben, abschreiben, kolportieren oder projizieren. Oft diente die Antike oder die Spätantike als Ideenreservoir. Andere Vorstellungen schöpften die Autoren aus dem Alten und dem Neuen Testament, insbesondere aus dem Leviticus und den Apostelbriefen. Nach Paulus (1 Kor 11,5–6) soll eine Frau, die betet, ihr Haupt bedecken. Ein unbedecktes Haupt sei gerade so, als wäre sie geschoren. Die Forderung wurde in die liturgischen Handbücher integriert und wiederholt auf Kirchenversammlungen diskutiert.
Bedeckten Hauptes sind in der spätmittelalterlichen Ikonographie indessen allein Witwen und Ehefrauen. Jungfrauen, die niht mannes hat, lautet das Kleidermandat der Stadt Speyer aus dem Jahr 1356, die mag wol ein schappel dragen unde ire zphe unde harsnre lassen hangen, biz daz sie beraten [verheiratet] wird. Ehefrauen und Witwen hatten seit dem 12. Jahrhundert das „Gebende“ zu tragen, ein Kopfschleier, der Oberkopf, Ohren und Kinn miteinander verbindet und zugleich verdeckt. Den Paulusbrief vor Augen, versteht sich auch besser, weshalb die Städte so sensibel darauf reagierten, wenn Frauen Männerhüte trugen.
An die Gemeinde von Korinth schreibt Paulus weiter (1 Kor 11,4): „Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt.“ Auf dem Retabel des Hochaltars der Nördlinger St.-Georgs-Kirche kniet die Stifterfamilie, die Familie Herlin, ehrfurchtsvoll in ihren Stifterbänken, die Frauen links, die Männer rechts von Christus mit entsprechenden geschlechtsspezifischen Bildprogrammen. Friedrich Herlin, der Vater, kniet betend auf der vordersten Bank, hinter ihm kommen, nach Altersschichten gestaffelt, seine ihrerseits betenden Söhne und Schwiegersöhne. Alle haben gemäß Paulus ihre Hüte, Mützen und Kappen abgelegt.
In seinem Praeceptorium divinae legis kritisiert der westfälische Augustiner-Eremit Gottschalk Hollen, manche, namentlich adlige Personen bzw. Männer, wollten bei der Epistellesung nicht sitzen, sondern stehen, weil Paulus, dessen Briefen die meisten Episteln ja entnommen sind, wie sie ein Adliger, also ein Standesgenosse, gewesen sei. Andere Kirchgänger behielten aus demselben Grund beim Evangelium ihre Kopfbedeckung auf. Gesten der Ehrerbietung wie das Aufstehen oder das Hutabnehmen hatten sich im Spätmittelalter anscheinend selbst in der Kirche ständisch ausdifferenziert. Daß Wilhelm Durandus in seinem Rationale divinorum officiorum zweihundert Jahre früher schon dieselbe „Anekdote“ erzählt, irritiert. Der Befund konfrontiert uns abermals mit der heiklen Frage, welche Realität geistliche und weltliche Literatur eigentlich abbildet, wenn sie so lebhaft, anschaulich und zum Greifen nahe „Realität“ darstellt.
Gegen die Eitelkeit der Frau hatten sehr früh schon Kirchenmänner wie Tertullian, Cyprian und Hieronymus das Wort ergriffen. Ihre Schriften waren von langanhaltender Wirkung, wie der Ménagier de Paris (1396) oder der 1371/72 verfaßte Livre du chevalier de la Tour Landry zeigen. Letzterer erfuhr dank Übersetzung und Buchdruck gesamteuropäische Verbreitung. Noch Bernardino da Siena donnerte zu Beginn des 15. Jahrhunderts über die Putzsucht der Frauen – seine treusten Zuhörerinnen – von der Kanzel herab: Sie färbten sich das Haar blond und verbrachten Tage auf der Dachterrasse, um es aufzuhellen. Sie schminkten sich, um die Haut weißer aussehen zu lassen, und liefen jeder Modetorheit hinterher, selbst wenn sie von Prostituierten ausgehe. „Nicht von ungefähr“, schließt I. Origo das Kapitel „Bernardino und die Frauen“, „waren in den Jahren, als Bernardino predigte, in Siena und auch in Florenz eine Reihe von Luxusgesetzen, leggi suntuarie, verabschiedet worden.“ Noch drastischer waren in dieser Hinsicht die Auswirkungen der Predigten von Capestran und Savonarola. Auf ihre fanatischen Appelle zur Maßhaltung folgten vielerorts sogenannte „Verbrennungen der Eitelkeiten“. Unter „Eitelkeiten“ verstand man Spiele, Schmuck und Kopfputz von Frauen, wie unter anderem die Bamberger Capestran-Tafel (1470/ 1475) zeigt.
GABRIELA SIGNORI