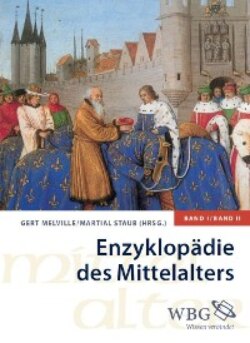Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 53
Lebenszyklus – Geburt, Erziehung, Generationen, Alter, Krankheit und Tod
ОглавлениеSchwangerschaft und Geburt. In vormodernen Gesellschaften ist das Frausein wesentlich von der Möglichkeit geprägt, Kinder zu gebären und großzuziehen. Zuweilen erscheint die Möglichkeit auch als Zwang, wenn Unfruchtbarkeit sich in das opprobrium sterilitatis verwandelt. Doch suchte und fanden Mediziner und Theologen die Erklärung für Kinderlosigkeit keineswegs immer, zuerst und allein bei den Frauen. Im Gegenteil: Weit häufiger als Unfruchtbarkeit diskutierte man im Spätmittelalter über Impotenz. Aufgerollt wurde das Thema bei Hexerei- und Zaubereiprozessen (Schadenszauber) [↗ Magie, Zauberei, Hexerei] oder bei Scheidungen vor dem geistlichen Gericht. Gemäß kanonischem Recht war Impotenz neben Ehebruch und Blutsverwandtschaft einer der Hauptgründe, die eine Scheidung legitimierten, zumal theoretisch; in der Praxis überwogen eindeutig die Klagen auf Ehebruch. Die „Weibergerichte“, die den Sachverhalt beidseitig (bei Mann und Frau) zu klären hatten, fanden in der Forschung vielfach Beachtung, allerdings vorzugsweise als kulturhistorisches Kuriosum.
Schwangerschaft und Geburt waren von zahlreichen Gefahren begleitet. Dementsprechend breit präsentiert sich die Palette der „volkstümlichen“ Abwehrmittel (Gebete, Gürtelauflegen, Segen etc.). Die Gründe, weshalb es zu Frühgeburten und Geburtskomplikationen kam, sind zu weiten Teilen dieselben wie heute. Auch die Gefahren, denen Mutter und Kind während der Geburt ausgesetzt waren, haben sich letztlich nicht grundsätzlich verändert: Erwähnt seien die habituellen Aborte, Drehung des Embryos im Mutterleib, Zwillingsgeburten, Gestoseprobleme und ähnliches. Das Kindbettfieber, im Spätmittelalter schlicht „das Fieber“ genannt, war bekannt, bekannt auch sein tödlicher Ausgang, wie das pseudo-ortolfische Frauenbüchlein lehrt. Aber weit weniger scheinen daran gestorben zu sein als im 19. Jahrhundert, nach dem Aufkommen der Geburtskliniken. Zuweilen mutet das Mittelalter „fortschrittlicher“ an als die Moderne. Bei Problemen mit der Nachgeburt empfielt dasselbe Frauenbüchlein, zum Erstaunen des Herausgebers etwa: Die, welhin nemen ein hefamme, die klein hend hat/vnd thn darumb ein tchlin, das da gedunckt ist in baumle vnnd die tht dann die hand in die heymlich stat vnd ledigt da ab gemchlich das prüdlin.
Die Zahl der Früh- und Fehlgeburten sowie die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit waren beachtlich. Im Notfall durfte das Kind im Mutterleib getauft werden, nach dem Rationale des Wilhelm Durandus aber nur, wenn es den Kopf zeigte (Rationale divinorum officiorum VI 83, S. 425). So lesen wir in Anton Tuchers Haushaltsbuch (S. 174): Anno 1489 adi 27 abrill montag ein stund vor tag ist mein weib einß kindß gelegen, ist ein sun gewest Wol[f]gang genant, der ist in muterleib getauft und czu hant gestorben. In articulo mortis war es den Laien bzw. der Hebamme gemäß kanonischem Recht auch erlaubt, die Nottaufe selbst vorzunehmen. Ja, es scheint sogar die Pflicht des Priesters gewesen zu sein, die Hebammen seiner Gemeinde darin zu unterweisen, wie sie in äußerster Not die Kinder taufen mußten. Nach John Mirks „Handbuch für Gemeindepriester“ (Manuale sacerdotis) brachte man ihnen in England die lateinische Formel bei; im Reich scheint man Übersetzungen benutzt zu haben, wie dem Konstanzer Ritualienbuch aus dem späten 15. Jahrhundert zu entnehmen ist (S. 41): Ich tauffe dich im namen Gottes Vatters vnd deß Sohns, vnd deß heiligen Geists. Amen. Demselben Ritualienbuch zufolge unterschied sich das Taufzeremonial je nach Geschlechtszugehörigkeit des Täuflings [↗ Taufe].
Trotz der Möglichkeit, Nottaufen vorzunehmen, sind in ganz Europa, vornehmlich seit dem 15. Jahrhundert, bemerkenswert viele Taufwunder belegt, die von einer kurzfristigen (zur Taufe nötigen), wunderbaren Wiedererweckung totgeborener Kinder berichten. Ein Beispiel neben vielen anderen ist die Geburt der Anna Hartzachmoserin, Frau des Rudi Locher aus Brunnadern im Neckertal. Anna lag drei Tage lang in den Wehen. Schließlich gebar sie ein totes Kind (Stiftsarchiv St. Gallen, Bd. 388b, Nr. 40): Do hand sy [Hebamme und Mitfrauen] das kind badet ain gantze stund, als man dan in solichen ntten tüot. Doch nicht das Bad oder, wie andernorts belegt, die Wärme des Feuers, erst das Wallfahrtsgelübde führte bei Annas Kind zum erwünschten Ziel. Einige Kultstätten spezialisierten sich auf die kurzfristige Wiedererweckung von Früh- und Totgeburten, darunter der Marienwallfahrtsort Oberbüren im heutigen Kanton Bern. Hier liegen interessanterweise auch entsprechende archäologische Befunde vor.
Viele Krankheiten stellten sich erst im Wochen- bzw. Kindbett ein, bemerkt der Autor des pseudo-ortolfischen Frauenbüchleins. Er wolle sich hier aber auf diejenigen Krankheiten beschränken, die mit dem Wochenfluß – die Rede ist von vnflat, der sich während der Schwangerschaft ansammle – zusammenhingen. Der „Unflat“ begründet in der Sicht der früh- und hochmittelalterlichen Kirche das Ritual der Aussegnung. Trotz der Kritik Gregors I. behauptete sich vielerorts die Vorstellung, daß weder menstruierende Frauen noch Wöchnerinnen das Kirchengebäude betreten dürften. Zumindest in der Theorie war die Frage ab Mitte des 12. Jahrhunderts zu Frauengunsten entschieden: Das kanonische Recht (D. 5 c. 1 und 2) spricht sich grundsätzlich zugunsten der Wöchnerinnen aus. Doch ging die Praxis, wie angedeutet, häufig andere Wege. Zu beachten ist indessen – darauf hat schon P. Browe mit Nachdruck hingewiesen –, daß das Aussegnungsritual der Wöchnerin in der Westkirche meist aus einem einfachen Krankensegen bestand. So überhaupt werde die körperliche Unreinheit der Frau darin nur kurz angedeutet. Auch die Gebete, mit denen sie vierzig Tage nach der Geburt in die Kirche eingeführt wurde, enthielten gewöhnlich nur Danksagung und Bitte um weiteren Schutz.
Erziehung. Indifferenz sei, meinte 1973 Ph. Ariès, die logische Folge der hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit. Zu viele Kinder seien gestorben, als daß sich im Mittelalter intensive Emotionen hätten entwickeln können. Ariès’ Einschätzung gilt heute als überholt. Briefe, Wundergeschichten sowie die Darstellung von Säuglingen und Kleinkindern in der spätmittelalterlichen Profan- und Sakralkunst sprechen eine andere Sprache. Auch das reichhaltige „Angebot“ an Spielsachen (Kreisel, Stelzen, Laufräder, Reifen, Steckenpferdchen, Puppen, Windrädchen und vieles mehr), das Ikonographie und Archäologie zu Tage gefördert haben, läßt an der These zweifeln, emotionale Gleichgültigkeit habe vorgeherrscht.
Die Arbeiten von J. Piaget legen nahe, daß Psychologie zu weiten Teilen eine Erfahrungswissenschaft ist, die sich dem eröffnet, der genau beobachtet. Die unterschiedlichen Fähigkeiten der verschiedenen Altersgruppen waren aus ebendieser Beobachtungsgabe auch im Mittelalter bekannt. Ihnen trugen einzelne Autoren, die sich mit dem Thema Kinder- bzw. Fürstenerziehung beschäftigten, auch Rechnung.
In ihrem „Buch über den Staatskörper“ breitet Christine de Pizan, selbst Mutter mehrerer Kinder, ihr Wissen für den angehenden Herrscher aus. Sie stützt sich dabei primär auf die antike Pädagogik, benutzt aber auch „moderne“ Erziehungsschriften und notiert hier Selbsterlebtes, da Gehörtes. Über die deutschen Edelherren etwa habe sie vernommen, daß sie ihre Kinder seltsamerweise früh anderen zu Diensten übergäben. Der Brauch irritierte den Venezianer, der um das Jahr 1500 in England zu Besuch war. Im Unterschied zu letzterem meinte Christine de Pizan, dies sei zweiffelos ein gesundes Mittel gegen Überheblichkeit.
Erziehung zur Tugend gründe auf Gehorsam. Leibesübung und Diät hingegen stärkten den Körper, ergänzt die Autorin an anderer Stelle. Wie in den meisten Fürstenspiegeln der Zeit stehen die Leibesübungen im Dienste der Waffenkunst, der zweiten Säule der Staatskunst. Der Augustiner-Eremit Ägidius Romanus will damit den angehenden Fürsten zugleich vor Verweiblichung schützen.
Spätestens seit dem 12. Jahrhundert erwartete man von jedem Herrscher Schriftkenntnisse. Das Sprichwort galt: rex illiteratus quasi asinus coronatus. Die ersten Schritte in Richtung von „Bildung“ werden mit kleinen, leicht erlernbaren Gebeten gemacht. Erst mit fortgeschrittenem Alter sollten die etwas anspruchsvolleren Stundengebete gelernt werden. Wichtiger als Lehrpläne ist es der Autorin ohnedies, darin folgt sie Jean Gersons De parvulis ad Christum trahendis, den angehenden Herrscher zur Frömmigkeit zu erziehen [↗ Königtum]. In Anlehnung an Gregor I. empfiehlt Kardinal Johannes Dominici in seiner Erziehungsschrift (S. 26): „Sorge dafür, daß sich in deinem Hause Bilder von heiligen Knaben oder Jungfrauen befinden. An diesen soll sich dein Kind, ich möchte sagen, noch in den Windeln, erfreuen als an seinesgleichen, da es an diesen Bildern den Ausdruck seines eigenen Verlangens finden wird.“ Dominici empfiehlt an erster Stelle Darstellungen Unserer Lieben Frau mit dem Jesuskind sowie Darstellungen des Jesuskindleins in Begleitung Johannes’ des Täufers und Johannes’ des Evangelisten als Kinder. „Man könnte ihm Furcht und Abneigung vor den Waffen und den Soldaten einflößen“, fährt er fort, „indem man ihm die Ermordung der unschuldigen Kinder zeigt.“
Christine de Pizan setzt sich auch eingehend mit den nötigen Qualitäten eines königlichen Hauslehrers auseinander, rät diesem von körperlicher Züchtigung ab (ähnliches hatte schon Anselm von Canterbury vertreten) und klärt ihn über die Bedeutung auf, die das Spiel in der geistigen Entwicklung eines jeden Kindes, auch eines Prinzen, einnimmt. Im Gegensatz zu Ägidius Romanus, der von Halbgöttern redet (De regimine principum II 2,8), vermenschlicht Christine de Pizan ihre Fürsten konsequent und fordert sie auf, ihre „Vergänglichkeit zu erkennen“, will ihnen zeigen, daß sie „genauso schwach wie jeder andere Mensch ohne jeden Unterschied“ seien, nur – als Geschenk Fortunas – über mehr irdische Güter verfügten als alle anderen. Für Ägidius Romanus war es, um auf das Spiel zurückzukommen, nur ein Mittel, Fürsten von „unerlaubten Gedanken“ (illicita) abzubringen (De regimine principum II 2,13). Spielen sei, meint hingegen Christine, für die Entwicklung des Kindes unabdingbar. Mit kleinen Gegenständen, chosettes, und Kindergeschichten, contes enfantibles, solle man den jungen Prinzen manchmal auch zum Lachen bringen (Le livre du corps de policie, S. 8). Später (genaue Altersangaben fehlen) solle man den Fürsten den Frauen, die ihn bis dahin ernährt und erzogen hatten, wegnehmen und einem erfahrenen Ritter übergeben. Heldenmut und Tapferkeit stehen fortan auf dem Lehrplan. Auch sie wollten gelernt, niemandem in die Wiege gelegt sein. „Auch“ müsse man, fährt die Autorin fort (ebd., S. 12f.), „den Sohn des Fürsten, selbst wenn er noch ein Kind ist, in den Rat mitnehmen, dahin, wo die weisen Männer und königlichen Berater versammelt sind, die über die Bedürfnisse des Landes entscheiden“. Wissen erwirbt man nicht allein beim Lesen und Hören, sondern auch durch Übung, Nachahmung und Erfahrung – „learning by doing“ im heutigen Sprachgebrauch [↗ Curricula].
Nicht nur adlige Eltern, um kurz auf den deutschen und englischen Brauch zurückzukommen, seine Kinder in fremde Dienste zu geben, sondern auch bürgerliche schickten im Spätmittelalter ihre Kinder an den Hof, um höfische Umgangsformen, Etikette zu erlernen, verrät Niklas von Wyles Frauenlob. Dem Schreiben der Erzherzogin Mechthild von Österreich an ihre Schwägerin Margarete von Württemberg ist zu entnehmen, daß es sich dabei um ein Dienstverhältnis mit Vertragscharakter handelt, den Lehrlingsverträgen nicht unähnlich, die man in den Städten vorwiegend für seine Söhne (selten für seine Töchter) abschloß (Steinhausen, Deutsche Privatbriefe, Nr. 117).
Erziehung ist eine Sache, Bildung eine andere, Sozialisation noch eine andere. Dennoch sind die drei Ebenen der Vergesellschaftung über die Jahrhunderte hinweg eng miteinander verwoben. Am besten erfoscht sind die für den Adel entwickelten Erziehungsprogramme [↗ Adel; ↗ Höfischer Raum], Tischzuchten und andere „Anstandsbücher“ sowie Stundenpläne und Lesestoff der älteren Kloster- und der jüngeren Stadt- und Humanistenschulen [↗ Glaube und Wissen]. Sehr früh debattierte man in diesem Zusammenhang auch die Frage nach dem schädlichen Einfluß bestimmter Lesestoffe auf den jugendlichen Leser. Völlig fremd war den Autoren die Einsicht aber nicht, daß „schlechte“ Lektüre vor allem dem schadet, der dafür „prädisponiert“ ist. Anders als Basil der Große, der in seinem De legendis antiquorum libris vorgibt, wie allen Gefahren zum Trotz heidnische Autoren auch im Schulunterricht nützlich sein können, entschied sich Hieronymus in seinem Lehrplan für die kleine Paulula für die Heilige Schrift als Grundlagenlektüre. Den unterschiedlichen Fähigkeiten des Alters entsprechend beginnen die Bibelstudien mit den Psalmen und enden, wenn jede Gefahr der Fehldeutung gebannt ist, mit dem „Hohen Lied“. Später strich man das „Lied der Lieder“ lieber aus dem Lehrplan für Jugendliche. Nach Dionysios dem Kartäuser und anderen spätmittelalterlichen Exegeten sollte der Leser des Hohen Lieds mindestens dreißig Jahre alt sein. So praktizierten es auch die Juden, rechtfertigte man sich.
Auch Ritterromane, besonders den Lanzelot und ähnliche Stoffe, erachtete man im späten Mittelalter für Kinder und Jugendliche als schädlich, weil sie zur Sünde der Ausschweifung einluden. Vorbehalte äußerte man außerdem gegen den Alexanderstoff, weil er, lautet hier die Begründung, die jungen Fürsten den Traum der Weltherrschaft träumen ließ. Noch andere Autoren wandten sich gegen Handbücher zur Magie (Chiromantie, Nekromantie, Pyromantie etc.), nicht allein wegen mangelnder Reife der Leser. Noch andere schließlich, darunter wiederum Christine de Pizan, setzten den Rosenroman auf den Index der für Kinder und Jugendliche verbotenen Schriften. In den Enseignements moraux, die sie ihrem Sohn widmete, fordert sie: „Wenn du keusch leben willst, dann lies das Buch der Rose nicht, auch nicht Ovids Kunst zu lieben.“ Zur Stärkung der Frömmigkeit empfiehlt sie Bernhard von Clairvaux, für die Darstellung von Schlachten das Speculum historiale des Vinzenz von Beauvais. Die Diskussion über moralisch Anstößiges war aber viel älter als die hitzige Debatte, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts der Rosenroman auslöste. Schon 1274 verboten die Kirchenväter, die sich in Lyon versammelt hatten (Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Bd. 24, Sp. 132), daß im Grammatikunterricht aliqua turpia leguntur, per quae juvenes ad lasciviam excitantur.
Junge Männer/Junggesellen. Kanonischem Recht gemäß galten Mädchen mit zwölf, Knaben mit vierzehn als erwachsen bzw. heiratsfähig. In der Praxis waren die Altersgrenzen hingegen äußerst anpassungsfähig, äußerst beweglich. Vormundschaftsverträge und Testamente legen nahe, daß die jungen Männer ihre Rechtsfähigkeit häufig erst um die zwanzig erlangten, in Einzelfällen sogar erst im dreißigsten Altersjahr.
„Junggesellen“ und alleinstehende Frauen, die nie geheiratet hatten, sind mit Sicherheit kein Produkt der Moderne. Systematisch erforscht ist die Frage für vormoderne Gesellschaften aber noch nicht. Dann und wann erscheinen Töchter fortgeschrittenen Alters in den Zivilgerichtsakten, die zeitlebens ihre betagten Mütter gepflegt hatten. Lebenslange Ehelosigkeit läßt sich auch bei vielen Mägden beobachten, dazu verpflichtet waren sie aber (noch) nicht. Zuweilen begegnen wir selbst Ratsherren fortgeschrittenen Alters, die, aus Gründen, die wir heute nicht mehr rekonstruieren können, nie geheiratet hatten. Doch handelt es sich nördlich der Alpen um eine Ausnahmeerscheinung, südlich der Alpen hingegen um politisches Kalkül, wie die Untersuchungen von S. Chojnacki zeigen. Venedig stellte seine jüngsten Söhne „frei“, um Politik als Beruf zu betreiben. Die wirklich wichtigen Ämter erhielten aber auch in Venedig nur diejenigen Männer, die verheiratet waren. Nördlich der Alpen begann die politische Karriere erst nach dem Eheschluß. Das Familienbuch des Frankfurter Geschlechts Rohrbach zeigt, mit welcher Ungeduld die jungen Männer den Tag herbeisehnten, an dem sie in den Rat gewählt würden. Unter Freunden (Männer und Frauen gemeinsam) wurden sogar Wetten abgeschlossen, wer denn zuerst im Rat vertreten sei (Frankfurter Chroniken, S. 213): Item 1471 uf crastina sancti Antonii gab Bernhard Rorbach uf Limpurg 4 maß malvasier uf ein daggut, welcher der dazumal anwesenden personen der erst zu rat burgermeister oder schöpf zu Frankfurt gekoren würde der es itzo nit wäre, solte es bezalen. Mehr als einen Vertreter eines Geschlechts im Rat zu haben war in den meisten Städten unerwünscht. Dementsprechend lange mußten die jungen Männer zuweilen auf den so heiß begehrten Tag warten.
Außerhalb der Erziehungsschriften wie dem Chevalier de la Tour Landry oder dem Ménagier de Paris ist bemerkenswert wenig von jungen Frauen die Rede. Erwähnt werden sie allenfalls bei Turnier und Tanz oder als Empfängerinnen eines Maikranzes, drei Themenbereiche, die noch unzureichend erschlossen sind. Anders verhält es sich, wie wir schon bei der Hosenlänge beobachten konnten, mit den jungen Männern, einer lautstarken Gruppe über die verschiedenen Zeiten und Kulturen hinweg, wie die Untersuchung von D. Gilmore zeigt. Vielerorts waren bzw. wurden sie dementsprechend auch als Problem wahrgenommen. Sowohl auf dem Land als auch in der Stadt entwickelten sie eigene Bräuche und Verhaltencodes. Zuweilen verfügten sie auch über eigene Orte und Räume, wie die nach Altersgruppen differenzierten Frankfurter Herrenstuben lehren. Mit sechzehn Jahren trat Bernhard Rohrbach der „Jungmännerstube“ zum Laderum bei; mit achtzehn war er Stubenmeister; mit zwanzig Jahren wechselte er zur politisch bedeutsamen Gesellschaft zum Limburg; mit 33 Jahren schließlich zur exklusiven Gesellschaft zum Frauenstein.
Die historische Kriminalitätsforschung hat sich schon verschiedentlich mit der besonderen Gewaltbereitschaft der jungen Männer auseinandergesetzt, den „fleurs du mal“ der spätmittelalterlichen Stadt (É. Crouzet-Pavan). Die Antworten fallen bemerkenswert uneinheitlich aus. Nur in einem Punkt scheinen sich die historischen Kriminologen von heute einig: Gewaltausübung war im Mittelalter kein Unterschichtenphänomen.
Generationen. In jeder Gesellschaft bedarf der Bezug zwischen den Generationen einer verbindlichen Regelung [↗ Verwandtschaftliche Ordnungen]. Heute nennen wir dies „Generationenvertrag“. Diskutiert wurde die Frage im Mittelalter vornehmlich im Kontext des vierten Gebots. „Seine Eltern ehren“ heißt für den Franziskaner Marquard von Lindau, ihnen in sichtagen vnd auch in kranckheit beizustehen und sie mit speiße vnd mit der notdrft des leibes zu versorgen (53f.). Der etwa zur gleichen Zeit entstandene Gewissensspiegel Martin von Ambergs exemplifiziert das vierte Gebot an den tugendhaften Störchen und spielt damit auf seine naturrechtlichen Implikationen an. Der Spiegel des Sünders, ein katechetischer Traktat aus dem 15. Jahrhundert, poltert (S. 246): Hastu dann deinen vatter vnd mter in irer kranckheyt, in irem alter oder ander notturft nit dein vermúgen vnd hilff, auch außwartung getrewlich mitteylt, ist dir tdlich. Unterlassene Hilfestellung, droht der Spiegel, sei eine Todsünde. Die Autoren unterscheiden nicht nach Geschlecht des zu unterhaltenden Elternteils. Auf den bildlichen Darstellungen des vierten Gebots hingegen kämmt die Tochter der Mutter das Haar und füttert der Sohn den Vater. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts verändert sich die Ikonographie des vierten Gebots grundsätzlich: Wie bei Hans Baldung Griens Illustration zu Marquard von Lindaus Zehn Geboten knien Tochter und Sohn ehrfürchtig vor Vater und Mutter, die herrschaftlich vor ihnen sitzen bzw. thronen. Im Mittelpunkt des Bildgeschehens steht nicht mehr die Idee der gegenseitigen Fürsorgepflicht, sondern der ungleiche Dialog zwischen Vater und Sohn, dem die Mutter abweisend beiwohnt. Von dem Gespräch ausgeklammert ist auch die Tochter, deren Blick schräg nach unten auf ihren Bruder fällt. Immer mehr Kinder redeten auch in stadtbürgerlichen Kreisen ihren Vater fortan mit „Herr Vater“ an und benutzten im Zwiegespräch das distanzierte „Ihr“ anstelle des „Du“. Zuweilen fällt im Austausch zwischen Eltern und Kind im ausgehenden 15. Jahrhundert sogar der Begriff der Untertänigkeit. So grüßt ein Görlitzer Schüler seine Mutter mit den Worten (Steinhausen, Deutsche Privatbriefe, Nr. 40): Kintliche undertenikeit mit warer libe steticlichen zcuvor. Dennoch gingen Norm und Praxis unbeschadet ihre eigenen Wege. Es regierten die Väter noch lange nicht allein.
Alter. Entsprechend dem oben skizzierten „Generationenvertrag“ hatten die Kinder für ihre betagten Eltern aufzukommen. Glaubt man den Predigern und anderen Moralisten, drückten sich die Kinder indessen gerne vor ihrer Fürsorgepflicht. Ein Blick in die Haushaltszusammensetzung korrigiert ihre pessimistische Sicht der Dinge. Die häusliche Alten- und Krankenpflege [↗ Heilkunde und Gesundheitspflege] wie auch die private Betreuung von Geistesgestörten sind in der Forschung stark vernachlässigt worden, vielleicht, weil sie schon im Mittelalter vorwiegend von Frauen getragen wurden. Die Aufmerksamkeit galt nahezu ausschließlich den dafür zuständigen Institutionen, vor allem den Spitälern, seltener den speziell für alte Menschen gestifteten Armen- oder Beginenhäusern, wie das Mendelsche Zwölfbrüderhaus (1388) oder die Stiftung des Mainzer Patriziers Jeckel zum Jungen zur Eiche (1442) zugunsten seiner langjährigen Mägde Grethe und Lyse.
Erschlossen ist die Welt des spätmittelalterlichen Spitals vorwiegend aus dem Blickwinkel der Stiftungsbriefe, der Satzungen, des Baus, der Pfleger, der Pfründenarten, der Speisepläne und der an Meister, Knechte und Mägde bezahlten Löhne. Demgegenüber sind unsere Kenntnisse über die „Belegschaft“ bzw. deren soziale Zusammensetzung noch erstaunlich schmal. Sind Pfründnerlisten bekannt, sticht häufig der hohe Anteil an Mägden ins Auge sowie die Quartiersverbundenheit bei der Auswahl der Institution. Die Mehrzahl der Städter scheint es aber vorgezogen zu haben, ihre „Alterspfründen“ bei Verwandten, Nachbarn oder anderen Bekannten zu erstehen, zu demselben Preis wie eine gemeine „Spitalpfründe“. Eine weitere Möglichkeit bestand darin, sich bei Klöstern und Stiften eine Pfründe zu erstehen. Systematisch ausgewertet sind die Klosterarchive in dieser Hinsicht aber noch nicht.
Literatur und Kunst nach zu urteilen, herrschten sogenannte „Agismen“, negative Vorurteile alten Menschen gegenüber vor. Wenig Respekt zollten ihnen Sprichwort, Schwank und Fastnachtspiel, ebensowenig Kalenderbilder und Kirchstuhlschmuck. Alte Menschen imaginierte man sich als kälteempfindlich und geizig und meinte ferner, sie neigten zur Trunksucht. Besonderes Interesse erweckte im Kontext von Witz und Schwank auch ihre Sexualität, wobei man sich seit der Antike alte Frauen als unersättlich, alte Männer als lüstern und impotent vorstellte [↗ Sexualität], vor allem im Kontext eines Eheschlusses mit einem jüngeren Ehepartner, im Kontext des „ungleichen Paars“. Der Eindruck entsteht, eine Gesellschaft, die – demographisch betrachtet – überwiegend aus jungen Menschen besteht, räche sich in Schwank und Witz dafür, daß gewöhnlich die Alten das Zepter führen. In diese Richtung deutet auch das Fastnachtspiel.
Die ihrerseits in die Antike zurückweisende Vorstellung, alte Menschen seien besonders weise, war im Mittelalter nicht unbekannt. Auch genuin christliche Vorstellungskomplexe wie die Propheten und Patriarchen oder die Legenden und Sinnsprüche, die sich um die Wüstenväter (Vitae patrum) woben, bauten letztlich auf der engen Verbindung von Alter und Weisheit auf. Gegen die negativen Altersstereotype durchzusetzen vermochten sich diese Vorstellungen jedoch nicht.
Krankheit. Die Medizingeschichte [↗ Heilkunde und Gesundheitspflege] beschäftigt sich gewöhnlich mit dem „Know-how“ der Ärzte, mit medizinischen Lehrbüchern und Traktaten, Diagnosen, Therapien, Diäten und ähnlichem mehr sowie vorzugsweise mit der Geschichte der Seuchen und anderen Zivilisationskrankheiten, allen voran der Pest, die den spätmittelalterlichen Menschen in bedrückender Regelmäßigkeit heimsuchte. Demgegenüber ist unser Wissen über das breite Spektrum von Krankheiten, die lästig, aber nicht tödlich sind, vorderhand noch äußerst bescheiden. Diesbezügliche Informationen enthalten unter anderem die concilia und die im Spätmittelalter massenhaft überlieferten Wunderprotokolle, die aufgesetzt wurden, um die Heilkraft eines Heiligen zu beweisen. Eine weitere, wichtige Informationsquelle sind die „Privatbriefe“ aus Kloster und Welt.
Ganz oben auf der Beschwerdeliste der Wunderprotokolle steht, auf Männer und Knaben bezogen, der Lendenbruch. Andere Votanden quälten Zahnschmerzen, Städter anscheinend mehr als die Landbevölkerung, vielleicht weil in der Stadt mehr genascht wurde als auf dem Land. Noch andere, vorwiegend Frauen, beklagten sich über heftige, aber sehr diffuse Beschwerden, die sie nicht zu lokalisieren vermochten. Dieselben Wunderprotokolle zeigen ferner, daß das Körperverständnis der Laien ein anderes war als dasjenige der Ärzte und Chirurgen. Krankheiten „überkamen“ oder „überfielen“ einen meist ausgesprochen hinterhältig und sie wanderten, ebenso unberechenbar, von Ort zu Ort, verließen die Oberfläche des Körpers aber selten. Kenntnisse der Säftelehre sind in den Wunderbüchern bis ins späte 15. Jahrhundert kaum nachzuweisen.
Dank Buchdruck verbreiteteten sich im Spätmittelalter medizinische Traktate und Rezepte rapide, die, in moderner Begrifflichkeit, Selbstdiagnose und Selbstmedikation förderten. Die Lektüreerfahrungen spiegeln sich nicht nur in der Wahl der Heilmittel wider; sie wirkten sich auch einschneidend auf die Körperwahrnehmung und das Krankheitsverständnis der Leser aus, wie etwa Francesco Datinis Briefe oder das Buch Weinsberg nahelegen. Zum Ehepaar Datini bemerkt I. Origo, sie hätten ein nahezu grenzenloses Vertrauen in Medizin und Ärzte gehabt und brauchten bzw. mißbrauchten ohne Unterschied jedes Medikament, das man ihnen verschrieb.
Zumal in den Städten war das Gesundheitswesen personell gut bestückt: Jedes Quartier verfügte über einen Bader, einen Scherer bzw. einen Wundarzt, der im Stande war, offene Wunden zu heilen. Dazu kamen Hebammen in städtischen Diensten und im ausgehenden 14. und 15. Jahrhundert immer häufiger ein eigener Stadtarzt, der trotz Studium keineswegs automatisch in die Reihen der städtischen Führungsschichten aufstieg. Dies zeigt Mitte des 15. Jahrhunderts ein langwieriger Prozeß zwischen der Stadt Basel und Brigitta Balmoserin, der Tochter des früheren Stadtarztes Konrad von Meißen. Konrad war völlig mittellos auf Kosten der Stadt im Spital verstorben. Zu den spätmittelalterlichen Stadtärzten liegen zahlreiche lokalgeschichtliche Monographien vor, aber kaum vergleichende, über die Stadtgrenzen hinausweisende Untersuchungen.
Das Verhältnis zwischen Arzt und Patient war ein „privatrechtliches“. Blieb die erwünschte Heilung aus, mußte gewöhnlich nicht bezahlt werden. Weiterführende Untersuchungen verdienten nicht nur diese Verträge, sondern, wie eingangs erwähnt, die Consilia-Literatur, die uns Einblick in das Wirken universitär geschulter Ärzte gewährt. Meister Guillaume Boucher zum Beispiel, der um 1400 in Paris wirkte, stellte einem Mann, „der über Koitusprobleme und die Sterilität seiner Frau flüsterte“, folgendes Rezept zusammen, „um zunächst die Nieren zu stärken“ (Nr. 83): „Zimt, weißer Ingwer, Cardamom, Samen von der Vogelzunge, Knoblauchsamen […] Wolfshoden, die Vorhaut eines Stieres […] All dies sollte zu Pulver gemahlen, mit flüssigem Honig versüßt und mit feinem Moos gemischt werden.“
Tod. Nach Ph. Ariès, einem der Väter der französischen Mentalitätsgeschichte, läßt sich die Geschichte des Todes im Abendland in vier Phasen unterteilen: „den gezähmten Tod“, „den eigenen Tod“, „dein Tod“ und „den verbotenen Tod“, als Charakteristikum des Zeitalters der modernen Apparatemedizin [↗ Sterben]. Mit dem „gezähmten Tod“ meint Ariès den idealen Tod, auf den man, mit sich selbst im reinen, geduldig wartet, der einen sanft hinübergleiten läßt. Ariès weiß, daß es sich dabei um ein Ideal handelt, das Zeit- und Kulturgrenzen überspringt. Dennoch versteht er den „gezähmten Tod“ als eine spezisch feudale Erscheinungsform. Demgegenüber habe im späteren Mittelalter die Auseinandersetzung mit dem Tod quasi obsessionelle Züge angenommen. Auf die Geburt des Fegefeuers folgte die Erfindung des Makabren. In Ariès’ Entwicklungsmodell melden sich die Hinterbliebenen erst spät zu Wort; spät auch tritt das Sich-am-Leben-Festklammern in Erscheinung. Zweifel an der Linearität seines Entwicklungsmodells wurden seit Erscheinen des Buches von verschiedenen Seiten erhoben. Einer der eindrücklichsten Gegenentwürfe bleibt A. Borsts „Drei mittelalterliche Sterbefälle“.
Ambivalenter als von Ariès vermutet sind auch die im Spätmittelalter entworfenenen und häufig gedruckten artes moriendi in Gestalt illustrierter Blockbücher oder kleinerer Erbauungsschriften. Einerseits spielen sie mit der Furcht vor dem Tod; andererseits stellen sie ein Set an Verhaltensregeln zusammen, die dem, der sie befolgt, einen friedvollen Tod verheißen. Ähnlich lautet die Botschaft der bildlichen Darstellungen des Marientodes. Keine andere Szene sei so geeignet, den perfekten Tod zu beschreiben, bilanziert K. Schreiner, wie der apokryphe Transitus Mariae. Dementsprechend imitierten der Künstler, der das Leben der heiligen Hedwig illustrierte, sowie derjenige, der das Hinscheiden der berühmten Nürnberger Äbtissin Caritas Pirckheimer darstellte, eben den Marientod.
Die Bestattungsfrage ist über die Jahrhunderte hinweg eine eminent soziale Frage. Das hat schon Ariès erkannt. Allein in Krisenzeiten trat der einzelne hinter das Kollektiv zurück, griff man unter anderem aus hygienischen Gründen auf Massengräber zurück. Bei den unter anderem von Boccaccio geschilderten Massengräbern zu Pestzeiten, kritisieren allerdings einige Anthropologen, handle es sich um einen literatischen Topos. Selbst bei den Massengräbern habe man sich darum bemüht, ein Mindestmaß an Ordnung einzuhalten, und legte man nebeneinander, was durch Familienbande zueinandergehörte.
Schon im 14. Jahrhundert sind obrigkeitliche Bemühungen bezeugt, das Leichenbegängnis zu regulieren bzw. den Aufwand an Geistlichen, Messen, Kerzen und am Leichentuch einzudämmen. Einzuschränken versuchte man auch die Zahl der zum Leichenschmaus geladenen Gäste. Des weiteren verboten Ratsmandate und Konzilsbeschlüsse im Spätmittelalter die Bestattung von Laien im Kircheninneren. Die Wohlhabenderen wichen zusammen mit der niederen Geistlichkeit vielerorts in den Bereich des Kreuzganges aus. Die Grabplatten erscheinen uns heute als Medium postumer Selbstinszenierung, deren Bedeutung für sozial-, kultur- und mentalitätsgeschichtliche Fragen seit längerem bekannt ist. Im 15. Jahrhundert wählte man anstelle von Grabplatten immer häufiger Wandepitaphien. Ihre Ikonographie verrät einen veränderten Jenseitsbezug: Schützend stellt sich der Namenspatron oder ein anderer Schutzheiliger hinter die Effigie des Verstorbenen und hält für ihn Fürsprache beim Jüngsten Gericht.
Die meisten Menschen wurden auf dem Friedhof vor der Kirche beigesetzt. An die Stelle der Grabplatte trat hier schon früh das Kreuz. Auf dem Friedhof befanden sich spezielle „Orte“ für spezielle Tote (unter anderem für Wöchnerinnen und ungetaufte Säuglinge). „Outcasts“ wurden hingegen auf dem „Schindacker“ beigesetzt. Im 15. Jahrhundert verbreitete sich in der Stadt und auf dem Land der Brauch, ältere Knochen auszugraben und in Beinhäusern („Karnern“) beizusetzen. Besondere Ehrung kam diesen am Allerseelentag zu, wie die von Thüring Fricker in Auftrag gegebene „Geistermesse“ (um 1505) zeigt.
Nach C. Burgess und B. Kümin ruhte die mittelalterliche Kirche auf den Schultern der Toten: Der Großteil ihrer Einnahmen entstammte aus Stiftungen, die im Dienste des Totengedenkens standen, allen voran die Stiftung von Jahrzeiten, die spezifisch spätmittelalterliche Form des Totengedenkens [↗ Memoria]. Das gilt von der Kathedral- bis hinunter zur einfachen Dorfkirche. Allein die Preise unterschieden sich markant. Als besonders kostengünstig erweisen sich die Sammeljahrzeiten der Mendikanten, als besonders teuer ein Gedenktag mitsamt jährlicher Grabbegehung in einer spätmittelalterlichen Kathedrale. Anders als das früh- und hochmittelalterliche Nekrologium hat das spätmittelalterliche Jahrzeitenbuch allerdings noch wenig Beachtung gefunden.
GABRIELA SIGNORI