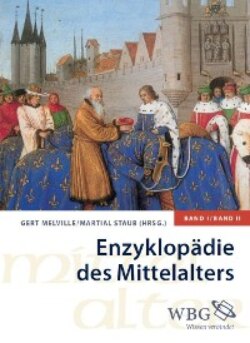Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 51
Frauen in der Gesellschaft
ОглавлениеIn der älteren Frauen- und Geschlechterforschung stand wiederholt die Frage zur Diskussion, ob denn den Frauen eine „Renaissance“ beschieden war. Die Antworten fallen bemerkenswert uneinheitlich aus. S. Chojnacki meint, in Venedig, seinem Untersuchungsobjekt, habe es nie so viele reiche Frauen gegeben wie im 16. Jahrhundert. Auch die Geistesgeschichte neigt dazu, die Frage zu bejahen. An „berühmten Frauen“, Ehefrauen, Töchtern oder Müttern berühmter Männer, mangelt es im Zeitalter der Renaissance (sowohl südlich als auch nördlich der Alpen) ja nicht. Aber gelehrte Frauen hatte es auch früher gegeben. Dafür bedurfte es der wiederentdeckten Antike nicht. Wenngleich: Zunächst waren es humanistisch interessierte und patriotisch gesinnte Gelehrte, die berühmte Frauen, unter anderen Hrotsvith von Gandersheim und Hildegard von Bingen, für ihresgleichen neu entdeckten.
Für die Stadt nördlich der Alpen hingegen gilt das Spätmittelalter als das „Goldene Zeitalter“ der Frau [↗ Städtischer Raum]. Ausschlaggebend sind rechtliche Gründe. Stadtluft mache frei, jubeln die älteren rechtshistorischen Handbücher. Heute deutet und gewichtet man das Freisein etwas anders. Dennoch: Die Stadt schuf lästige Heiratsbeschränkungen ab und führte, zumal nördlich der Alpen, flächendeckend die Realerbteilung ein. Töchter und Söhne erbten fortan gleich. Darauf achtete man gewöhnlich auch sehr genau. Ebensogenau nahm man es zuweilen auch mit der „politisch“ korrekten Anrede, wenn Bruderschaftsstatuten beispielsweise unermüdlich die Doppelbezeichnung „Schwestern und Brüder“ benutzen.
Das Spätmittelalter ist ein heterogener Zeitbereich. Seine Charakterisierung als „Goldenes Zeitalter“ für Frauen bezieht sich, wie wir noch sehen werden, vor allem auf das 13. und 14. Jahrhundert. Anders als in Venedig, scheinen sich zumal nördlich der Alpen im Verlauf des 15. Jahrhunderts die Handlungsräume von Frauen zu verengen. Einschneidende Folgen hatte in dieser Hinsicht die Rezeption des römischen Rechts, das in vielen Städten nördlich der Alpen zusehends mit dem Gewohnheitsrecht in Konkurrenz trat.
Die rechtliche Gleichstellung von Tochter und Sohn blieb, wie es scheint, auf dem Land die Ausnahme, wenngleich die Forschungslücken in dieser Hinsicht beachtlich sind [↗ Bauerntum; ↗ Ländlicher Raum]. Untersuchungen zum spätmittelalterlichen Landbesitz von Frauen liegen mit Ausnahme von J. M. Bennetts Studie zu Brigstock derzeit nämlich kaum vor. Unsere Vorstellungen sind von der Rechtsgeschichte der Jahrhundertwende geprägt, in der sich die zeitgenössischen Diskussionen widerspiegeln, die die Einführung des BGB begleitet haben. H. Fehr statuierte in seiner 1912 erschienenen Studie zu Mutter und Kind in den Weistümern, auf dem Land seien Frauen prinzipiell vom Erbgang ausgeschlossen gewesen. Viele spätmittelalterliche Zinsbücher und Urbare, zuweilen auch die Inschriften über den Türen alter Bauernhäuser, sprechen eine andere Sprache. In den Zinsbüchern des Zürcher Frauenmünsters (Ende 14. Jahrhundert) lautet ein Eintrag neben vielen vergleichbaren: Item Greta, Rdis Cno tochter, 2 ß von ir hus und hofstat. Wenn keine Söhne (mehr) vorhanden waren, erbten auch Töchter. Und von diesen Erbtöchtern gab es anscheinend mehr, als längere Zeit vermutet.
Frauengüter, Ehegüter. Untergraben wurde die städtische Errungenschaft der Realerbteilung anscheinend da, wo das Mitgiftwesen unter dem Einfluß des römischen Rechts bizarre Blüten trieb. Doch die Entwicklung vom „Brautpreis“ zur Mitgift war weder „universell“ noch linear. Auch vermochte die Mitgift die Brautgabe nicht völlig zu verdrängen, wie Ch. Klapisch-Zuber für Florenz gezeigt hat. Der dritte und letzte Punkt: Nicht immer und überall bedeutete Mitgift automatisch Erbverzicht. Anton Tucher (S. 176ff.) beispielsweise stattete seine älteste Tochter mit einem „Heiratsgeld“ von 800 Gulden aus. Von einem Erbverzicht ist nirgends die Rede. Seine jüngste Tochter Barbara hingegen erhielt insgesamt 2.100 Gulden. Damit einher ging in ihrem Fall dann tatsächlich der Verzicht auf das elterliche Vermögen. Doch, ist zu vermuten, dürfte die Summe mit ihrem Erbteil identisch gewesen sein.
Die hohen Geldbeträge, die für die Töchter von Florenz und Venedig aufgebracht wurden, seien, wendet A. Molho ein, a priori kein Zeichen von Diskriminierung. In ihnen spiegle sich primär die hohe Wertschätzung der Frau wider. Alessandra Macinghi negli Strozzi, Mutter von fünf Kindern, staffierte 1447 ihre Tochter Caterina mit tausend Gulden aus. Die Hälfte des Betrags hatte sie beim monte degli dotti, bei der städtischen Mitgiftkasse angespart. Sie wolle das beste für ihre Tochter, erklärte Alessandra ihrem Sohn Filippo (Nr. 1): „So habe ich, alles wohlbedacht, beschlossen, das Mädchen gut auszustatten und auf anderes nicht zu achten.“ Der junge Gemahl bedankte sich, indem er die Braut als Brautgabe fürstlich einkleidete (schon wieder Kleider). Auch darüber informierte Alessandra Filippo genauestens: „Und als ich sie verlobte, ließ er ihr den Stoff für ein Überkleid aus karmesinrotem Samtbrokat zuschneiden und dazu ein Unterkleid vom selben Stoff: das schönste Zeug, was es in ganz Florenz gibt, in seiner Werkstatt gefertigt. Dazu bekommt sie ein Gewinde aus Federn und Perlen, das auf 80 Gulden zu stehen kommt, darunter ein Kopfputz, und dazu zwei Reihen geflochtener Perlen im Werte von 60 Gulden oder mehr. So wird sie, wenn sie das Haus verläßt, über 400 Gulden an sich tragen. Ferner hat er ein rotes Samtgewand in Auftrag gegeben, mit weiten Ärmeln und mit Marder gefüttert, für den Tag ihrer Hochzeit. Endlich noch ein rosenfarbenes Überkleid, mit Perlen bestickt: er weiß gar nicht, was er aufstellen soll; denn sie ist schön, und er möchte sie noch schöner ausstaffieren.“ Kleider und Schmuck sind hier eindeutig als Brautgabe zu verstehen.
Nach A. Molho ist der strategische Nutzen der hohen Mitgiften lange Zeit überschätzt worden. Geschäfte mit der Heiratsverwandtschaft seien, gibt er zu bedenken, zumindest beim venezianischen Adel nämlich sehr selten gewesen. Ihr traute man offenbar nicht genügend.
Das Mitgiftwesen beschränkte sich längere Zeit zum einen auf die Oberschichten, zum andern auf den mediterranen Raum. Nördlich der Alpen waren die Eheberedungen und -Verträge schichtenübergreifend gewöhnlich anders gestaltet. Das betrifft auch die Brautgabe, die hier als Morgengabe figuriert. Der Mann brachte als „Widerlegung“ in der Regel ebensoviel in die Ehe ein wie die Frau in Gestalt der „Heimsteuer“. Als ein Beispiel neben anderen sei der Ehevertrag zwischen dem Lüneburger Hans Boltzen und der Lübeckerin Herdeke Pleskowe kurz erwähnt (Stadtarchiv Lüneburg, Städtische Urkunde, 18. Oktober 1407). Abgeschlossen wurde er auf neutralem Terrain in Mölln, einer Hansestadt zwischen Lübeck und Lüneburg. Anstelle der verstorbenen Väter agierten die Bürgermeister der beiden Städte sowie Ratsmänner bzw. Verwandte von Braut und Bräutigam. Festgehalten wird zunächst Herdekes Heiratsgut: zwei Stadtrenten in Lübeck und Wismar in der Höhe von dreißig und achtzehn Mark, ein Bett sowie Kleider, unter anderem ein roter, mit Hermelin gefütterter Mantel. Eine Rente von fünfzig Mark geht als Widerlegung im Todesfall an Herdeke zurück. Die fünfzig Mark entsprechen den beiden von Herdeke eingebrachten Renten. Den Ehevertrag stellte man doppelt aus, aber auf einem Bogen Papier. Der Bogen wurde in der Mitte durchgeschnitten und die zwei Hälften den vier „Gedingsleuten“ übergeben (also nicht den Eheleuten), den beiden Bürgermeistern und nächsten männlichen Verwandten in Lübeck und Lüneburg. Bleibe die Ehe kinderlos, präzisieren die Verträge gewöhnlich, fielen Heimsteuer und Widerlegung an die nächsten Verwandten zurück. Geteilt wurde mit einem von Stadt zu Stadt anderen Teilungsschlüssel allein das gemeinsam Erwirtschaftete und gemeinsam Erworbene, vorausgesetzt es lagen keine anderslautenden Abmachungen vor. Wo der Teilungsschlüssel die Frauen gewohnheitsrechtlich benachteiligte, entwickelten sich früh entsprechende Rechtsmittel, das Gewohnheitsrecht außer Kraft zu setzen: „Gedinge bricht Recht.“ Zu einem ähnlichen Resultat ist B. Pohl-Resl im übrigen schon für das 8. Jahrhundert gelangt. „Zahlreiche Männer“, beobachtet sie, „waren offenbar daran interessiert, ihre Frauen besser abzusichern, als es in den Leges vorgesehen war, und ignorierten zum Teil die strengen Gesetze.“
Die Morgengabe war Sondergut im Besitz der Frau, selbst für Gläubiger unantastbar. Zuweilen finden sich Morgengaben aber auch in Männerhänden. Dabei handelt es sich um junge Männer, die eine Witwe geheiratet hatten. Anders als bei der Heimsteuer und der Mitgift reichte die Morgengabe im Spätmittelalter aber nicht mehr, um damit standesgemäß zu „wirtschaften“. Die Morgengabe scheint primär ein symbolisches Kapital darzustellen. Dementsprechend häufig endete sie, war die Erblasserin kinderlos, als Geschenk an die Kirche.
Ehemänner, die sich am Besitz ihrer Frauen vergriffen, gibt und gab es zu allen Zeiten. Epochenspezifisches läßt sich in dieser Hinsicht schwer erkennen. Mißbrauch blieb aber die Ausnahme. Die rechtlichen Bestimmungen sowohl des kanonischen als auch des städtischen Ehegüterrechts waren reichlich kompliziert. Trotzdem: Ohne Einstimmung der Frau durfte der Mann ihren Besitz nicht veräußern. Geschützt waren die Interessen der Frau zuweilen auch durch gerichtlich einklagbare mündliche Eheberedungen oder schriftliche Eheverträge.
Tatkräftige Unterstützung fanden die Frauen, ging es um ihren Besitz, gewöhnlich beim Klerus, wenngleich dessen Engagement, wie sich noch zeigen wird, nicht immer ganz selbstlos war. In aller Schärfe verurteilt Johannes von Paltz († 1511) Gesetze oder Gewohnheiten, „die den Männern erlauben, die Güter ihrer Frauen beliebig zu nutzen, und die zu ihrer Verarmung führten“. Solche Gesetze seien ungerecht und unvernünftig. Den Gedanken vertieft er in vier Unterkapiteln seines zu wenig beachteten Supplementum Coelifodinae: „Die Herrschaft und Leitung des Mannes über die Frau dient nicht der Zerstörung, sondern der Erbauung. So nämlich wie Christus den Aposteln die Autorität der Kirche nur zur Erbauung verlieh, wie in 2 Kor 10,8 gesagt wird, so verhält es sich mit der Herrschaft der Männer über die Frauen. Deshalb steht fest, daß jene [Männer] schlecht handeln, die die Güter ihrer Frauen in Tavernen und für Eitelkeiten vergeuden. Fest steht auch, daß sie von der öffentlichen Gewalt gezüchtigt werden müssen. Denn das ist nach keinem Gesetz oder keiner Gewohnheit rechtens, weil es gegen das göttliche und gegen das natürliche Recht verstößt.“
Geschlechtsvormundschaft. Johannes von Paltz spricht drei letztlich eng miteinander verwobene Problemfelder an: die schwierige Rechtsnatur des Frauenguts, die beschränkte Rechtsfähigkeit der Frau und schließlich die damit verbundene Institution der Geschlechtsvormundschaft. Im Fall der verheirateten Frau oblag diese automatisch dem Ehemann, dem „natürlichen Vogt“ in der zeitgenössischen Gerichtssprache. Die Geschlechtsvormundschaft beschränkte sich auf bestimmte Rechtsgeschäfte wie unter anderen Schenkungen, Immobilienverkauf und Bestellungen von Pfandrechten, Erbzinsrechten und Servituten. Die spätmittelalterliche Gerichtspraxis lehrt indessen, daß, wenn es um die Veräußerung von Eigenbesitz ging, der Ehemann die Vogteigewalt gewöhnlich ablegte und andere an seine Stelle traten. Die Geschlechtsvormundschaft war als Rechtsschutz gedacht und wurde so auch von den Legisten und Kanonisten diskutiert. Schon der Sachsenspiegel hatte den Jungfrauen und Witwen die Möglichkeit eingeräumt, gegen treulose Vormünder zu klagen. In vielen spätmittelalterlichen, auch in vielen norditalienischen Städten verzichtete man indessen völlig auf diese Einrichtung. In anderen Städten verkümmerte sie im Verlauf der Zeit zu einer von den Gerichtsknechten beherrschten Ad-hoc-Vormundschaft. Eher als Ausnahme zu betrachten ist insofern der Schritt des Straßburger Rates, der gegen Ende des 15. Jahrhunderts die zu lokker gewordene Schraube der Geschlechtsvormundschaft wieder fester anzuziehen begehrte. 1322 hatte man in Straßburg die Notwendigkeit, einen Geschlechtsvormund zu haben, an die Vermögenslage gebunden. Betroffen waren nur die Bürgerinnen, die im Kriegsfall der Stadt Hengste, Pferde oder Halbpferde zur Verfügung stellen mußten. In den Straßburger Urkundenbüchern des 14. Jahrhunderts lassen sich indessen keine „Vögte“ nachweisen. 1471 besann sich der Rat auf die Statuten von 1322 zurück. Im Blickpunkt seiner Aufmerksamkeit standen wiederum Jungfrauen und Witwen. Dabei ging es den Ratsherren nicht darum, Position gegen die Frauen zu beziehen, wie noch M. Wiesner meint, sondern die Schenkungen an die Kirche besser kontrollieren zu können. Dementsprechend entrüstet sich Geiler von Kaysersberg: Es ist nwelich ein statut gemacht/das den witwenn ein fogt geben wurt/on deß [dessen] wissen und willen/sie nutzet geben/schaffen/oder verschaffen mgen/ouch zu gotlichen dingen/oder armen luten von ligenden guttern/on ires fogts willen. Einen jungen Gesellen, schimpft Geiler weiter, der das väterliche Erbe mit Spielen, Prassen und hübschen Frauen vertue, hindere niemand an seinem Tun.
Frauenarbeit. Die Stadt bot für Frauen wie für Männer vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten [↗ Städtischer Raum]. Die Vielzahl der alleinstehenden und „erwerbstätigen“ Frauen überraschte an der Wende vom 19. zum beginnenden 20. Jahrhundert bürgerlich-liberal gesinnte Gemüter wie den Nationalökonomen K. Bücher. Bücher hatte sich als einer der ersten eingehender unter einem wirtschafts- und bevölkerungsstastistischen Blickwinkel den spätmittelalterlichen Steuerlisten zugewandt. Dabei war er eben auf die hohe Zahl „alleinstehender“ Frauen gestoßen. Seine Vorstellung von Arbeit als Lohnarbeit und Frauenarbeit als Zwang bzw. Produkt eines imaginären Frauenüberschusses sind, wie angedeutet, zeit- und standortgebunden und heute überholt. Das Dasein als alleinstehende Frau ohne Mann bedeutet nicht automatisch ein Leben in Armut oder am Rand der Gesellschaft, wendet P. Skinner ein. Armut wird im mittelalterlichen Sprachgebrauch überdies häufig als Begriff für Ohnmacht, Schutz- und Rechtslosigkeit verwendet. Armut im Sinne von materieller Bedürftigkeit wiederum assoziiert das Spätmittelalter primär mit Kinderreichtum; der zweite große Armutsfaktor im Verständnis der Zeit ist die altersbedingte Erwerbsunfähigkeit von Mann und Frau.
Sowohl auf dem Land als auch in der Stadt wirkten die meisten Frauen als gelernte Arbeitskräfte oder als ungelernte Hilfskräfte in der Textilproduktion oder im Haus als Mägde bzw. Jungfrauen in zeitgenössischer Begrifflichkeit. Aus England, Frankreich und Genf haben sich in beachtlicher Zahl schriftliche Lehrlingsverträge erhalten. Die wenigsten betreffen jedoch Mädchen, eine Folge der bis heute häufig fließenden Grenzen zwischen Frauenarbeit und Hausarbeit.
Im Reich und in der Eidgenossenschaft wurden die gegenseitigen Verpflichtungen von Lehrling und Lehrherr oder Lehrfrau selten schriftlich fixiert. Zufällig berichtet ein Eintrag in den Basler „Kundschaften“ von einem Hans Staler aus Waldshut, der 1476 seine Tochter Ennelin dem Ehepaar Senglin zur „Lehre verdingt habe“ (Staatsarchiv Basel-Stadt, Gerichtsarchiv D, Bd. 11, fol. 26v), nemlich spinnen am rad och von der hand vnd dar zü neigen. Bei Vertragsabschluß sei auch ausdrücklich festgehalten worden, bemerkte die Zeugin Ennelin Schwertfeger, die ihrerseits ursprünglich aus Waldshut stammte, das Mädchen nicht auf den Kopf zu schlagen. Nach K. L. Reyerson sind derartige Zusätze die Ausnahme. Erziehung bzw. Züchtigung werde in den Lehrlingsverträgen selten angesprochen. Die Zeugin aber, um auf das Basler Beispiel zurückzukommen, hatte verschiedentlich beobachtet, wie die Frau das Mädchen mit der Faust traktiert und ihr die Spindel aus der Hand gerissen habe. Es ging primär darum, vor Gericht zu beweisen, daß das Ehepaar Senglin und nicht das Mädchen vertragsbrüchig geworden war. Es ging also primär um Geld, nicht um die Frage der unrechtmäßigen Gewaltanwendung.
Fast alle Städte erlaubten Frauen mit Kapital, auf eigenverantwortlicher Gewinn- und Verlustbasis selbständigen Handel ohne „Vogt“ zu betreiben. Besondere Aktivitäten entfalteten die Frauen dennoch vor allem erst als Witwen, aber „durchaus nicht ausschließlich aufgrund der von den Männern geschaffenen Geschäftsbasis“, bemerkt M. Wensky zum spätmittelalterlichen Köln. Viele Frauen ließen sich schon zu Lebzeiten ihrer Männer als Kauffrauen, Gremperinnen, Käuflerinnen etc. nachweisen. Abgesehen von Köln, Wenskys Untersuchungsgegenstand, sind die städtischen Zunftarchive geschlechtergeschichtlich noch kaum genutzt. Im Folgenden seien hier knapp einige Tuchhändlerinnen und Tuchschererinnen vorgestellt, die sich in den Jahren 1382 bis 1408 in die Basler Schlüsselzunft, die erste und angesehenste der vier Herrenzünfte, einkauften: 1382 erwarben Martin Liker und sin wip das Zunftrecht. Ihr Bürge war Dikhut wip. In demselben Jahr trat Erhartz frouwe von Spir der Zunft bei sowie Ellin, des Weibels swester von Waldenburg, und das besagte Dickhut wip. Zum Jahr 1383 lautet der erste Eintrag: Die zem Rosen het die zunft empfangen. Damals wurde die Frau des Henman von Grindel auch das erste Mal wegen Tuchkürzens durch das Zunftgericht gebüßt. Im gleichen Jahr erwarb sich Henman Buchbarten wib, Katherina, das Zunftrecht. Ihr Bürge war ein gewisser Koller. 1387 wurde die Frau des Henman von Grindel das zweite Mal gebüßt, dieses Mal, weil sie grünes Tuch von Treysa als Dürener Tuch verkauft hatte. 1388 trat die von Angen aus der minderen Stadt (Kleinbasel) der Zunft bei sowie Henman Scherrers wib. Erst zwei Jahre später erstand sich Henmann, der aus dem elsässischen Hagental kam, das Bürgerrecht. 1389 wurde die von Arlesheim schlüsselzünftig. Ihr Bürge war Kunz Koller. Koller bürgte auch für die Frau des Messerschmieds Herterich, die in demselben Jahr der Schlüsselzunft beitrat. Nach 1400 werden Frauennamen immer seltener ins Zunftbuch eingetragen. Der Eintrag zum Jahr 1408 schließlich lautet ganz anders als in Jahren zuvor: Die Witwe des Klaus von Geispolzheim habe sich das Zunftrecht erstanden, um das Geschäft mit ihrem Knecht Nesselbach weiterzuführen.
Erwerbsarbeit ist in den vormodernen Wirtschaftsformen bekanntermaßen nur eine Variante der Vermögensbildung. Mit einem Vermögen von circa 12.600 Gulden war Sophia von Rotberg, die Witwe des Burkard Zibol und Schwester des Basler Bischofs Arnold von Rotberg, 1454 die zweitreichste Person der Stadt Basel. Doch Sophia interessierte sich nicht für das Geldverdienen. Das taten andere für sie. Zu ihrem Vermögen war sie ausschließlich über Erbschaften gelangt. Sie war die letzte derer von Rotberg, und als 1432 ihre einzige Tochter starb, ging auch der Besitz der Zibols mangels Erben an sie über. Ein Jahr nach dem Verlust ihrer Tochter ließ sie sich in der Nähe des Steinenklosters nieder und weitere neun Jahre später schloß sie mit den Nonnen einen Pfründenvertrag ab. In ein Kloster eintreten wollte sie nicht. Sie hatte sich für den semireligiosen Witwenstand entschieden, wie manch andere vornehme Frau ihrer Zeit, lehrt unter anderem die Studie von M. C. Erler. Demnach waren Rentenbesitz und Erbschaften, zwei Aspekte, die die ältere Wirtschafts- und Sozialgeschichte weitgehend ausgeblendet hat, ebenso wichtig wie die Erwerbstätigkeit. Selbst Mädge kauften sich Leib- oder zuweilen sogar Stadtrenten, wenn sie emsig genug gespart hatten. Sparsamkeit, parcimonia, figurierte schon im Spätmittelalter im bürgerlichen Wertekatalog. Renten waren übrigens die gebräuchlichste Art der Altersvorsorge für beide, Mann und Frau.
GABRIELA SIGNORI