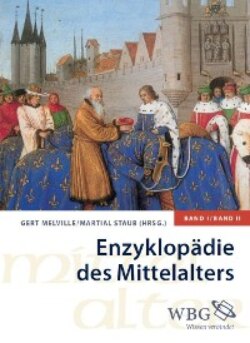Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 57
ОглавлениеIn der Frühzeit der Christengemeinden war deren Struktur vielfältig, noch nicht streng fixiert; und im Unterschied zu später scheinen Frauen ebenso geistliche Funktionen ausgeübt zu haben wie Männer. Doch schon während des 2., erst recht im 3. Jahrhundert scheinen Männer das Sagen übernommen zu haben, selbst wenn im Mittelmeergebiet (gerade auch in Rom) Frauen als presbyterissae und diaconissae bis zum 9. Jahrhundert heutzutage schwer fixierbare Aufgaben innehatten. Bereits für die Mitte des 3. Jahrhunderts bezeugte Eusebios in seiner Kirchengeschichte (4. Jahrhundert) für Rom, daß dort der Klerus unterhalb des Bischofs aus sieben, ausschießlich Männern vorbehaltenen, Gruppen bestand: den Ostiariern („Türhüter“), Lektoren (Leser bzw. Sänger), Exorzisten (Dämonenaustreibung vor der Taufe), Akolythen (Helfer des Bischofs), Subdiakonen (Helfer der Diakone), Diakonen (Sozial- und Verwaltungsfunktionen) sowie den Presbytern (Leiter der Teilgemeinden: Eucharistie und Seelsorge). Diese Gruppen überdauerten Spätantike und Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert; jahrhundertelang konnte ein Mitglied einer Gruppe, etwa ein Akolyth, sein Leben lang ein und derselben Gruppe angehören; und wegen der unterschiedlichen Aufgabenverteilung bildeten die Presbyter und Diakone die Spitzen von zwei unterschiedlichen Karrieren. Zumindest bis zum 10. Jahrhundert hatte ein neuer Papst zuletzt einer dieser beiden Gruppen angehört, meist derjenigen der Diakone. Und wegen ihrer Bedeutung war für beide Gruppen seit dem 5. Jahrhundert ein Mindestalter für den Eintritt vorgeschrieben: 25 Jahre für Diakone, 30 für Presbyter; auch mußten sie zölibatär leben. Anders verhielt es sich in anderen Gebieten der westlichen Christenheit, etwa in Spanien und Gallien: Dort gab es zwar auch die sieben Gruppen und die Vorschrift des Zölibats; doch war ein strenger Cursus für die Karriere vorgeschrieben, so mußte etwa ein Presbyter vor seiner Weihe alle anderen sechs Grade nacheinander innegehabt haben.
Bereits seit dem 4. Jahrhundert wurde die scheinbar klare Aufteilung des Klerus kompliziert, nämlich durch die Religiosen. Ja, lange Zeit gehörten sie überhaupt nicht zu ihm, sondern bildeten zwischen ihm und den Laien einen eigenen Stand [↗ Religiosentum]. Völlig ist diese Unterscheidung bis heute nicht aufgehoben. Doch vor allem seit der Karolingerzeit wurden auch die Religiosen als Kleriker begriffen. Verkürzt läßt sich dieser Wandel folgendermaßen erklären: Seit den Reformsynoden unter Ludwig dem Frommen (Aachen 816/17) wurden die Religiosen in Kanoniker und Mönche unterteilt; die ersteren sollten nach der „Aachener Regel“, die zweiten nach der Benediktregel leben; beide Gruppen sollten also nach einer fixierten regula, in einer bestimmten religio leben. Und während in der frühen Zeit des Christentums nur wenige Religiosen klerikale Weihen empfangen hatten, gab es nunmehr – vornehmlich in den Klöstern – immer mehr Religiosen, welche die Preisterweihe besaßen. Grund dafür waren zum Beispiel die Gebetsverbrüderungen, die – etwa in Cluny und in ähnlich strukturierten Klöstern – die Zahl der täglich zu zelebrierenden Messen anschwellen ließen. Diese Tendenz nahm mit den Reformbewegungen seit dem 11. Jahrhundert noch zu und kulminierte seit dem frühen 13. Jahrhundert in den Bettelorden. Und gerade diese engagierten sich noch stärker als frühere Bewegungen in der Seelsorge für Laien. Sie übernahmen also Tätigkeiten, die in der Frühzeit dem Klerus vorbehalten gewesen waren, oft mit großem Erfolg, der bei den eigentlich zuständigen Seelsorgern (Pfarrern etc.) Unruhe und Neid provozierte.
Gleichzeitig mit diesem Wandel wurde in der Theologie, noch stärker im Kirchenrecht [↗ Kirchenrecht], die Lehre von den Pflichten und Rechten der unterschiedlichen Gruppen von Klerikern nach oft langen Kontroversen fixiert. Entsprechend der Lebensform wurde der Klerus in zwei Hauptgruppierungen gegliedert: den Weltklerus (clerici saeculares) und den nach einer Regel lebenden Kloster- oder Ordensklerus (clerici regulares). Einen Zwitter bildeten die Säkularkanoniker (etwa in vielen Domstiften), die zwar nicht an eine feste Regel gebunden waren (abgesehen von Rudimenten der Aachener Regel), aber doch – zumindest tendenziell – die vita communis befolgten, also gemeinsam Messe und Stundengebet beiwohnten, regelmäßig im Kapitel praktische Fragen berieten und zusammen aßen und schliefen (all das seit dem 13. Jahrhundert häufig eher Theorie als Realität). Aber – und das sei nochmals betont – sie alle gehörten zum Klerus.
Wichtig ist zudem eine weitere Unterscheidung: die zwischen einem Amt und dessen Ausstattung. Wie der schon genannte Kirchenhistoriker Eusebios für Rom im 3. Jahrhundert vermerkt hatte, lebten dort die Kleriker von den Spenden der Gemeinde. Seit ca. 400 sollten in Rom die Spenden in vier Bereiche aufgeteilt werden: für den Bischof, für den Ortsklerus, für den Kirchenbau und für sozialkaritative Zwecke. Wahrscheinlich galt diese Viertelung auch für andere Ortsgemeinden. Im Karolingerreich sollten die Geistlichen in Pfarreien vom Zehnten ihrer Gemeindemitglieder leben und für ihre Kirche und deren Ausstattung sorgen. Kirchen, die ein (geistlicher oder weltlicher) Grundherr gestiftet hatte und weiterhin als Patron kontrollierte, hingen als „Eigenkirchen“ außerdem von der jeweiligen Dotierung ab. Bei Klöstern und Stiften kamen noch Stiftungen hinzu; auch sie waren häufig „Eigenkirchen“, vornehmlich des Königs oder Adels. Kurzum: Die Ausstattung der Kirchen war recht unterschiedlich und ihre personelle Besetzung richtete sich häufig nicht nach der geistlichen Eignung des Kandidaten, sondern nach dessen Beziehung zum Patron. Demzufolge besaß spätestens seit der Karolingerzeit für potentielle Interessenten die zu gewährende (praebenda = Pfründe) Ausstattung oft eine größere Bedeutung als die pflichtgemäße Ausübung des mit ihr verbundenen Amtes. Bei den bereits genannten Säkularkanonikern kam noch ein weiteres hinzu: Bis zum 11. Jahrhundert war das Einkommen von Bischof und Domkanonikern gemeinsam verwaltet und an die einzelnen verteilt worden. Dann jedoch wurde zwischen Einkommen des Bischofs (mensa episcopi) und des Domkapitels (mensa capituli) unterschieden. Und je mehr seit dem 13. Jahrhundert die vita communis von den meisten Domkapiteln aufgegeben, die Rangfolge der dortigen Ämter differenziert sowie die Einnahmen kapitalisiert wurden, desto mehr stieg die Attraktion bestimmter Kapitelsämter wegen der Höhe ihrer Pfründen. Fazit: Von Reformorden des 12. Jahrhunderts und den Bettelorden abgesehen, überwog bei der Besetzung geistlicher Stellen deren ökonomische Ausstattung häufig die Anforderungen an die geistliche Eignung des neuen Inhabers. Dieser Wandel hatte weitreichende Folgen. Dazu nur einige, wenige Beispiele.
Schon im 12. Jahrhundert, erst recht später, fungierten Bischöfe [↗ Bistümer] häufig lediglich als electi („Gewählte“); sie waren zwar „gewählt“, doch nicht geweiht. Demzufolge bezogen sie zwar alle Einkünfte ihres Amtes und besaßen alle Befugnisse für die ihrem Amt zustehende Gerichtsbarkeit und Verwaltung; doch die einem Bischof eigenen sakramentalen Handlungen durften sie nicht vollziehen. Dazu benötigten sie Personen, die zwar die Bischofsweihe erhalten hatten, doch keine eigene existierende Diözese besaßen, die später so genannten Weih- oder Hilfsbischöfe. Anfangs waren dies im 12./13. Jahrhundert aus ihren meist asiatischen Bistümern von Byzanz und vor allem von Muslimen vertriebene Bischöfe (episcopi in partibus infidelium); doch bestand diese Fiktion auch noch (bis heute), als es seit dem 13./14. Jahrhundert in Asien keine lateinischen Bischöfe mehr gab (spätestens seit 1368 mit dem Sieg der Ming-Dynastie in China). Diese Weihbischöfe besaßen zwar aufgrund ihrer Bischofsweihe oft einen höheren Grad als ihr bischöflicher Auftraggeber, waren jedoch von diesem vor allem finanziell abhängig. Nicht anders verhielt es sich in vielen Pfarreien, deren Leiter (rectores) nicht die Priesterweihe empfangen hatten. Sie benötigten für viele Amtspflichten (besonders Messe und Beichte) Vertreter (vicarii), die zwar zu Priestern geweiht waren, doch vom zuständigen Bischof keine Pfarre erhalten hatten, so daß sie einem ungeweihten Pfarrer zu Diensten sein mußten. Noch ärger erging es Priestern, die als Kapläne sich bei einzelnen Familien, Gilden, Zünften oder Bruderschaften als Zelebranten für bestimmte Messen verdingen mußten. Übrigens gab es auch in vielen Domkapiteln und anderen Kanonikerstiften so wenige oder gar keine Priester, daß sie Vikare einstellen mußten. All diese Vertreter besaßen gewöhnlich einen höheren Weihegrad als ihre Brötchengeber, waren aber zum Überleben auf deren Zuwendungen angewiesen. Bei vielen Vertretern können wir von einem geistlichen Proletariat sprechen. Aber auch sie gehörten zum Klerus.
Doch auch unter den vermeintlichen Standesgenossen gab es wegen der unterschiedlichen Ausstattung der Pfründen eklatante Diskrepanzen, gerade auch bei Bischöfen und Äbten als den Ranghöchsten. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts verfestigte sich in der Rechtspraxis, daß jeder zum Bischof oder Abt Gewählte der Nomination durch den Papst bedurfte, um seines Amtes zu walten [↗ Papsttum, Kurie, Kardinalat]. Und um die Nomination zu erhalten, mußte sich jeder Gewählte verpflichten, an den Papst eine Gebühr zu zahlen, das servitium commune. Dieses entsprach einem Drittel des ersten Jahreseinkommens des Kandidaten. Seit Bonifaz VIII. (1295–1303) sind Register erhalten, in denen jeweils die Verpflichtungen („Obligationen“) und Zahlungen („Solutionen“) vermerkt sind. Und weil der Zahlungspflichtige beantragen konnte, daß eine Kommission prüfe, ob die Summe seines servitium nicht zu hoch sei, also eventuell reduziert werden müsse, können wir davon ausgehen, daß die Registereinträge gewöhnlich korrekt waren, also uns erlauben, das Mindesteinkommen eines Bischofs oder Abtes zu errechnen. Stimmen diese Prämissen, dann wird deutlich, daß unter den Prälaten erhebliche Einkommensunterschiede bestanden. Abgerechnet wurde in Florenen (fl. = Florentiner Gulden, Goldwert: ca. 100 Euro). Die reichsten Bischöfe zahlten 12.000 fl. (Rouen, Winchester) oder 10.000 fl. (Aquileja, Narbonne, Auch, Köln, Salzburg, Canterbury, York); ihr Jahreseinkommen war also auf 30.000 fl. bis 40.000 fl. geschätzt. Hingegen war in Mittel- und Süditalien ein Drittel der Bischöfe vom servitium befreit, weil ihr Jahreseinkommen unter 100 fl. lag. Ähnliche Unterschiede gab es bei den Äbten: Die reichsten von ihnen (Cluny, Fécamp, bis 1362 St. Germain-des-Prés) zahlten 8.000 fl. – übrigens lagen alle Klöster, deren Äbte 5.000 fl. und mehr entrichten mußten, ausschließlich in Frankreich. Hingegen war zum Beispiel in Deutschland der Abt des angesehenen Klosters Fulda zur Zahlung von nur 300 fl. verpflichtet. Die unterschiedlichen Vermögen bestimmten nicht nur das öffentliche Auftreten der Prälaten, sondern dürften auch ihren Einfluß am päpstlichen Hof oder auf Konzilien und Synoden bestimmt haben.
Doch waren, wie schon angedeutet, auch Kanonikate, Pfarreien, Kaplaneien und andere Pfründen unterschiedlich dotiert. Als „arm“ galten die Stellen, die weniger als 24 fl. im Jahr erbrachten. Und weil spätestens seit Urban V. (1362–1370) die Besetzung vieler Pfründen dem Papst vorbehalten war und für sie die „Annaten“ (gleichfalls ein Drittel des Einkommens des ersten Jahres) gezahlt werden mußten, erlauben uns die Annatenregister einen Einblick in die regionalen und lokalen Einkommensstrukturen; allerdings sind die Angaben – anders als bei den Prälaten – lückenhaft, denn längst nicht alle Pfründen wurden vom Papst verliehen. Ausnahmen bildeten etwa Pfarrer, die von ihrer Gemeinde gewählt wurden, oder Kanoniker, deren Stellen der jeweilige Herrscher besetzte – so wurden etwa viele königliche „Beamte“ und Professoren an Landesuniversitäten durch Kanonikate „besoldet“. Und Kleriker, die ihren Lebensstandard heben wollten, sammelten („kumulierten“) Pfründen, insbesondere „Sinekuren“ (sine cura = ohne Verpflichtung zur Seelsorge), also Kanonikate, Kommenden („Übertragung“ einer Prälatur zur Verwaltung) etc. Eine weitere Spielart bildeten die Resignationen: Ein Kleriker verzichtet auf eine bisher besessene Pfründe zugunsten eines Dritten, der sich verpflichtete, dem Resignierenden aus der betreffenden Pfründe jährlich eine fixierte Summe (pensio) zu zahlen. Angesichts der vielen Möglichkeiten, die hier nur verkürzt angedeutet werden konnten, wundert es nicht, daß im späten Mittelalter der Pfründenhandel und daher der Pfründenmarkt das tägliche Leben vieler Kleriker bestimmte. Daher waren diese, so sie denn studierten, häufig weniger an theologischen Lehren, sondern eher an Kenntnissen des Kirchenrechts – vor allem des Pfründenrechts – interessiert, was die Eignung zum Seelsorger nicht gerade förderte.
Doch ob reich oder arm: jeder Kleriker genoß Vorrechte, die ihn von den Laien abhoben. Daß er diese, gleich zu beschreibenden, Rechte besaß, also zum „Stand“ des Klerus gehörte, zeigte er nach außen oft schon durch die Kleidung, erst recht durch einen besonderen Haarschnitt: die Tonsur. Besonders bei Mönchen schon in der Spätantike bezeugt, zeigte spätestens seit dem Frühmittelalter die Tonsur die Zugehörigkeit ihres Trägers zum Klerus an, zum Säkular- oder zum Regularklerus. Während anfangs unterschiedliche Arten bestanden hatten, wurde in der lateinischen Kirche allmählich die „Petrustonsur“ üblich, die Schur einer kleinen Rundung am Scheitel. Weil das Haar nachwuchs, mußte die Schur regelmäßig wiederholt werden, für deren Häufigkeit es unterschiedliche Regelungen gab.
Jeder Tonsurierte besaß besondere Rechte, vornehmlich das privilegium immunitatis und das privilegium fori. Das erste sicherte ihm die Freiheit von weltlichen Pflichten, etwa vom Kriegsdienst und von Zahlung von Abgaben oder Steuern. Aufgrund des zweiten Privilegs war er der weltlichen Gerichtsbarkeit entzogen. Weil beide Privilegien auch ganzen religiösen Gemeinschaften (etwa Domkapiteln, anderen Stiften, Klöstern) und den diesen dienenden Laien zugute kommen konnten, war in vielen Städten die Geltung der Privilegien auch lokal fixiert, etwa in „Immunitäten“ oder „Freiheiten“; die Laien, die in ihren Genuß gekommen waren, zeigten häufig ihre Befreiung (libertas) durch eine besondere Kleidung (liberata, „livrée“) oder bestimmte sichtbare Kennzeichen an.
Beide Privilegien provozierten besonders im Spätmittelalter Konflikte zwischen Klerikern und Laien. Dazu ein paar Beispiele: Die gut zweijährige Sedisvakanz (1292–1294) nach dem Tode Papst Nikolaus’ IV. hatten der französische König Philipp IV., der Schöne, und der englische König Eduard I. dazu genutzt, den Klerus in ihren Ländern zu besteuern. Ihr Vorgehen führte zum ersten großen Dissens mit Papst Bonifaz VIII. Und in seiner Neigung, zugunsten seines eigenen Amtes zu polarisieren, hatte dieser 1296 in der Bulle Clericis laicos nicht nur dekretiert, daß Kleriker lediglich mit ihrer Einwilligung besteuert werden dürften, sondern gleich am Beginn betont, daß es typisch für Laien sei, die Kleriker zu unterdrücken. Deutsche Städte, wie etwa Augsburg, versuchten, die in ihnen lebenden Kleriker ins Bürgerrecht zu zwingen, um sie dadurch an den städtischen Unkosten zu beteiligen. In Bamberg war im 15. Jahrhundert der „Muntäterkrieg“ ausgebrochen, weil zum Beispiel einflußreiche Ratsmitglieder in Immunitäten wohnten, um sich so Verpflichtungen zu entziehen, die sie selbst im Stadtrat mitbeschlossen hatten.
Noch häufiger waren Auseinandersetzungen um das zweite Privileg; den Anlaß bildete häufig die Bestrafung krimineller Kleriker. Zum besseren Verständnis seien kurz die vier Strafen erläutert, die – abgesehen von der Exkommunikation – von geistlichen Gerichten über einen Kleriker verhängt werden konnten. Die beiden geringeren Strafen betrafen vor allem Amtsvergehen und konnten für eine bestimmte Zeit oder für immer ausgesprochen werden: Die Suspension enthob den Bestraften seines Amtes, die Privation beraubte ihn seiner Pfründe(n). Die beiden größeren Strafen bildeten – meist mit Einschluß von Suspension und Privation – die Deposition (Absetzung) und Degradation (Entziehung der Weihegrade). In der Spätantike und im Frühmittelalter waren beide Begriffe häufig synonym verwendet worden. Infolge des Streites (1164–1170) zwischen dem englischen König Heinrich II. und dem Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket, um die Zuständigkeit für die Verurteilung krimineller Kleriker wurden beide Strafen strenger voneinander geschieden. Die Deposition galt fortan als Höchststrafe für Kapitalverbrechen, die Degradation ahndete geistliche Vergehen. Einen besonderen Streitpunkt bildete die mit der Degradation verbundene traditio curiae („Übergabe an die Kurie“). Jahrhundertelang war sie vor allem als Wiedereingliederung in den Laienstand interpretiert worden; seit dem 12. Jahrhundert verstand man sie als Übergabe an den weltlichen Richter und damit als zweite Strafe nach der Degradation. Gemäß dem schon älteren Rechtssatz nihil bis in idipsum („kein Vergehen darf doppelt bestraft werden“) hatten Becket und sein päpstlicher „Schutzherr“, Alexander III., die traditio abgelehnt. Doch schon bald hatten Päpste – und daraufhin Kanonisten – sie wieder zugelassen, allerdings auf vier Tatbestände eingeschränkt: Widerstand gegen den Bischof, Rückfälligkeit eines schon Deponierten, Fälschung päpstlicher Urkunden und Häresie; in diese einbegriffen waren Assassinat (religiös motivierter heimtückischer Mord), Sodomie (Homosexualität oder Sexualverkehr mit Tieren) und später auch Hexerei. Für Degradation und anschließende traditio wurden seit dem 13. Jahrhundert spezielle ordines („liturgische Anweisungen“) für den ausführenden Bischof verfaßt, die oft – vornehmlich in Südfrankreich (Katharer) – recht grausame Riten beschrieben: Nachdem der Bischof dem Delinquenten die seinem Weihegrad entsprechenden Gewänder und Geräte weggenommen hatte, schnitt er bei Priestern und Bischöfen mit einem Messer von den drei Weihefingern der rechten Hand das Fleisch ab, bis die Knochen bloßlagen. Jedem Verurteilten, gleich welchen Weihegrades, kratzte er mit einer Glasscherbe die Tonsur auf dem Kopf aus. Anschließend übergab er den solchermaßen Skalpierten dem weltlichen Richter mit der seit Innozenz III. (1198–1216) vorgeschriebenen Bitte, jenen an Leib und Leben zu schonen; schließlich galt ja der Rechtssatz: „Die Kirche dürstet nicht nach Blut“ (ecclesia non sitit sanguinem). Natürlich wußte er, daß der Tradierte anschließend hingerichtet wurde; doch hatte er dem Recht Genüge getan.
Die Differenzierung von Deposition und Degradation stieß bei weltlichen Autoritäten häufig auf Widerstand, denn Deponierte wurden lediglich mit Klosterhaft bestraft, aus der sie nicht eben selten bald wieder entlassen wurden; sie wurden also weitaus milder bestraft als Laien, denen für Kapitalverbrechen die Todesstrafe drohte. Seit dem Konflikt Philipps des Schönen mit Bonifaz VIII. kam noch ein weiteres Delikt hinzu, das nach Ansicht von Herrschern mit der Degradation geahndet werden sollte: der Hochoder Landesverrat. Für Konflikte zwischen Klerikern und Laien war also gesorgt, und dies über das Mittelalter hinaus.
Doch gab es auch erfreulichere Aspekte, etwa die Klerikerfeste [↗ Feste]. Diese wurden in der Weihnachtswoche begangen, ehrten die jeweiligen heiligen Patrone der verschiedenen Weihegrade und sind spätestens seit 911 (Besuch der Abtei St. Gallen durch den ostfränkischen König Konrad I.) bezeugt. Gerade diese erste Erwähnung erweist, daß die Feste nicht auf Frankreich beschränkt waren, obwohl die späteren Hinweise gewöhnlich diesem Königreich galten. Am ersten Tag ehrten die Diakone den heiligen Stephanus (26. 12.), anschließend die Priester den Apostel und Evangelisten Johannes (27. 12.) und die niederen Grade die „Unschuldigen Kinder“ (28. 12.). Eine Sonderrolle spielten am 1. Januar die Subdiakone, galten sie doch noch im späten 12. Jahrhundert dem Liturgiker Johannes Beleth als „ungewisser Weihegrad“ (ordo incertus), weil sie einen Zwitter zwischen den niederen und höheren Weihegraden darstellten. Und während in den ersten Jahrhunderten ihrer Erwähnung die Feiern aus liturgischen Lesungen und Gesängen bestanden zu haben scheinen, wurde im 12. Jahrhundert gerade am Fest der Subdiakone eine auf den ersten Blick befremdliche Bereicherung erkennbar, weshalb es bald als „Narren-“ oder „Eselsfest“ bezeichnet wurde und die literarische Gattung der Satire um manche Texte im Mittellatein und Altfranzösischen bereichert hat. Wohl von vor- und außerchristlichen Traditionen am Kalenderbeginn stimuliert, prägten jetzt obszöne oder antizölibatäre Gesten und Handlungen das Fest. Wohl weil dies als Befreiung vom üblichen geistlichen Korsett empfunden wurde, ließen sich auch die anderen drei Gruppen für die Gestaltung ihrer Feste von diesem Wandel beeinflussen, was schon 1199 in Paris zum Leidwesen des dortigen Bischofs Odo in Messerstechereien ausartete. Kein Wunder, daß reformfreudige Theologen und Synoden zuhauf die Feste kritisierten und abschaffen wollten, doch vor dem 16. Jahrhundert ohne durchschlagenden Erfolg. Und in einigen Diözesen (etwa Paderborn) lebt – allerdings in harmloser Form – die Tradition fort, wenn am 28. 12. ein „Knabenbischof“ in der Bischofskirche das Regiment übernimmt.
Feiern ließ sich auch bei anderen Gelegenheiten. Ein Beispiel hierfür sind die Kalanden (fratres calendarii), ein vor allem norddeutsches Phänomen im Spätmittelalter. Entstanden aus der Gewohnheit, daß sich Kleriker einer bestimmten Region an den Kalenden, also am Monatsbeginn, trafen, schlossen sich diese bald zu Bruderschaften zusammen, um füreinander zu beten, bedürftigen Mitgliedern zu helfen, bestimmte Angelegenheiten zu beraten und die so manifeste Geselligkeit noch durch gemeinsames Feiern zu stärken. Später widerfuhr auch ausgewählten Laien beiderlei Geschlechts die Ehre, der jeweiligen Gemeinschaft anzugehören. Andererseits wurden die anfangs monatlichen Treffen auf meist zwei Termine im Jahr reduziert. Manchmal gab es vor Ort auch zwei Kalanden, die ständisch unterschieden waren. Und vor allem im 15. Jahrhundert kritisierten Laien, die wohl nicht zu ihnen gehörten, die Kalanden, weil das Gesellige – insbesondere die Gastmähler – zu einseitig die Treffen dominierte.
Auch anderswo existierten derartige Bruderschaften, so etwa in Rom. Schon seit 984 bezeugt, hatten sich dort Geistliche zu einer Gebetsgemeinschaft (fraternitas Romana) zusammengeschlossen. Im 11. und 12. Jahrhundert straffer organisiert und von Rektoren geleitet, wuchs die Bedeutung der Gemeinschaft desto stärker, je mehr sich die Kardinäle vom lokalrömischen Fundament lösten, aus Nichtrömern bestanden und sich auf den Papsthof konzentrierten. Und allmählich umfaßte die Gemeinschaft alle römischen Kleriker unterhalb des Kardinalats. Bei Konflikten innerhalb der römischen Kirche konnte die Gemeinschaft die Opposition zur „international“ orientierten Kurie bilden, so etwa im Schisma von 1159, als die Bruderschaft den „kaiserlichen“ Kandidaten, Viktor IV., unterstützte. Trotzdem wuchs noch ihre Bedeutung. Wie noch 1325 Johannes XXII. bestätigte und ein in Turin aufbewahrter Kirchenkatalog (von ca. 1320) genauer beschreibt, leiteten die zwölf Rektoren nicht nur 414 Kirchen mit 785 Säkularklerikern (einschließlich der Gerichtsbarkeit), sondern auch die römische Universität (Verwaltung, Berufung der Dozenten). Doch hatte schon der genannte Papst versucht, die Zuständigkeitsbereiche der fraternitas einzuschränken. Diese Tendenz erstarkte im 15. Jahrhundert mit der für Jahrhunderte geltenden Stadtherrschaft des Papstes, so daß die Bruderschaft in der Neuzeit keine Rolle mehr spielte. Gegenüber aufmüpfigen Gliedern der eigenen Diözese hatte, wie auch oft im weiten Rund der Universalkirche, der Papst als Monarch obsiegt. Doch nicht für lange: Vor allem seit dem „Abendländischen Schisma“ (1378–1417) ersetzten Landesherren immer stärker den päpstlichen „Leiter des Erdkreises“ (rector orbis); und gerade der Klerus degenerierte immer mehr zur herrscherlichen Verfügungsmasse bei der Ämterbesetzung. Aber auch die klerikalen Standesprivilegien wurden durchlöchert seitens der verschiedenen „Obrigkeiten“, die im Verein mit den Kritikern der „Pfaffen“ ihre Kontrolle auch über den so lange widerspenstigen Stand ausweiten konnten. Das Terrain für die Reformatoren war bereitet.
BERNHARD SCHIMMELPFENNIG