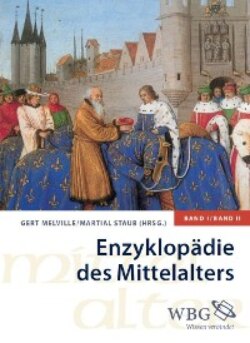Читать книгу Enzyklopädie des Mittelalters - Группа авторов - Страница 59
Juden
ОглавлениеUm das Handeln und Reagieren der Juden in der mittelalterlichen Gesellschaft Europas zu verstehen, müssen Fremdbild und Selbstbild dieser Bevölkerungsgruppe unterschieden werden. Beide Sichtweisen standen zunächst unversöhnlich nebeneinander, mußten aber im Interesse des nachbarschaftlichen Zusammenlebens an die sich wandelnden Bedingungen des Alltags angepaßt werden. Von dem das Denken der Mehrheitsgesellschaft bestimmenden Fremdbild soll zunächst die Rede sein.
Juden waren in der christlichen Welt des Mittelalters stets präsent, als unmittelbare Nachbarn wie auch als Verkörperungen des „verstockten“ Menschen überhaupt, der sich der erlösenden Botschaft Christi [↗ Nachfolge Christi] verschlossen habe und eine fortwährende Schuld an dessen Tode trage. Nach dem Verständnis der Zeit waren deshalb die Juden nicht eine unter vielen Minderheiten, sondern Angehörige einer Gruppe, auf deren schließliche Erlösung in der Endzeit man noch hoffen konnte. Sie stellten insofern nicht nur den verkörperten Beweis für die Existenz Christi dar, sondern sie bildeten auch den Widerpart, vor dessen Hintergrund man die christliche Lehre um so deutlicher abgrenzen konnte. Religionsdisputationen zwischen Juden und Christen, wie die literarisch überlieferten von Ceuta 1179 und die von Mallorca von 1286, waren keineswegs ehrliche Auseinandersetzungen zur Klärung möglicher Konfliktpunkte und Mißverständnisse, sondern allein Mittel zur Demonstration und Vertiefung des christlichen Wahrheitsanspruchs und zur Widerlegung der jüdischen Tradition.
Juden wurden damit nicht zum Bestandteil der christlichen Gesellschaftsordnung [↗ Politische Ordnungsvorstellungen], wohl aber zu einem Faktor, mit dem man rechnete und den man als solchen in das eigene Weltbild einbaute. Die Auswirkungen dieser Vorstellung im Alltag waren von den Polen der Exklusion und Inklusion bestimmt: Phasen der Verfolgung und Vertreibung wechselten mit solchen der friedlichen Nachbarschaft und nahezu gleichberechtigter Teilhabe (concivitas) am gesellschaftlichen Leben ab. Die am Ende des Mittelalters intensivierte theologische Diskussion über die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen Juden in einem Land zu dulden seien, bildet den theoretischen Niederschlag der ambivalenten Haltung der christlichen Gesellschaft gegenüber den Juden. Konsequenterweise galt seit karolingischer Zeit das Zugeständnis an die Juden, nach ihrem eigenen Recht leben zu dürfen (secundum legem suam vivere); ebenso stellte die Formel spätmittelalterlicher Schutzbriefe klar, daß die Schutzbefohlenen danach leben sollten, als judden recht unde gewonheit ist, denn Juden galten eben nicht als Teilhaber der christlichen Gesellschaft.
Völlig anders stellte sich demgegenüber das Selbstbild der mittelalterlichen Juden dar [↗ Judentum]. Diese bildeten spätestens seit dem 6. Jahrhundert eine Traditionsgemeinschaft mit ausgeprägtem Sendungsbewußtein auf religiöser Grundlage. Im Zentrum der jüdischen Lehre, die im Zeichen der Diaspora von den babylonischen Religionsschulen ausgebildet wurde, stand seit jeher die Vorstellung von einer noch zu erlösenden Welt in Erwartung des noch kommenden Messias. Sie stand damit von Anfang an im Gegensatz zur christlichen Erwartung einer besseren Welt, die freilich durch die schon geschehene Ankunft des Gottessohnes bereits erlöst worden war. Der Talmud im ursprünglichen Sinne verstand sich deshalb als eine Summe von Verhaltensanweisungen an den Menschen zur besseren Vorbereitung auf das Kommen des Messias. Eine weitere Konsequenz dieser Auffassung bestand in der Vorstellung einer gewissen Auserwähltheit und in dem Bewußtsein, selbst zum Werkzeug der messianischen Eschatologie auserwählt zu sein. Daraus entstand ein ausgeprägtes Sendungsbewußtsein, das auf die christliche Umwelt provozierend wirken konnte.
Erfolgreich konnte das sich im Laufe des Mittelalters verfestigende Selbstbild der Juden nur dadurch werden, daß es nicht auf die geistige Elite der Rabbinen beschränkt war, sondern zum Anliegen eines jeden Gläubigen gemacht wurde. Alle hatten die heiligen Schriften zu studieren, die sich daraus ergebenden religiösen Gebote zu achten und im täglichen Leben umzusetzen. Auf diese Weise entstand eine nivellierte und nivellierende Geisteshaltung unter den Juden, die jedem den gleichen Platz am Werk der Erlösung einräumte, auch wenn die Gelehrsamkeit der Rabbinen vorbildhaft wirken konnte. Das Lernen der Gebote wurde nicht als intellektueller Akt, sondern als eine spirituelle Technik verstanden, durch die die Erlösung vorbereitet werden konnte.
Die Erfahrung der Diaspora, des erzwungenen Lebens unter Fremden (gojim), führte jedoch dazu, daß von der unbedingten Geltung der Anweisungen von Thora und Talmud Abstriche gemacht werden mußten. Dies geschah mit dem – bereits im Talmud formulierten – Prinzip des dina d’malchuta dina, wonach „das Recht des Königreichs“ als verbindliches Recht anerkannt wurde. Jüdisches Recht behält seine Gültigkeit; doch das Recht des jeweiligen Landes, in dem die Juden wohnten, sollte von ihnen anerkannt werden. Doch wurde zugleich unterschieden zwischen dem „Gesetz des Landes (Königreichs)“ und dem „Raub durch den König (chamsanuta d’melech)“, das heißt zwischen dem gültigen und anzuerkennenden Recht auf der einen Seite und dem ungesetzlichen Handeln eines Herrschers. Wo somit der legitime Herrscher vom selbstgesetzten Landesrecht abwich, bestand aus halachischer Sicht keine Verpflichtung zum Gehorsam: Nicht blinder Gehorsam der Juden gegenüber der Obrigkeit war verlangt, sondern Unterordnung nur für den Fall gesetzlichen, rechtmäßigen politischen Handelns. Dies war nach Meinung der hochmittelalterlichen deutschen und französischen Rechtsgelehrten (chachme aschkenas v’zorfat) dann nicht der Fall, wenn der Herrscher das Gewohnheitsrecht eines Orts änderte oder ein neues Gesetz schuf [↗ Rechtsformen]. Dies wurde seit dem 13. Jahrhundert relativiert und durch das Kriterium ersetzt, daß das Herrschaftsrecht dann gültig sei, wenn es in der gesamten Herrschaft ohne Diskriminierung einzelner Gruppen angewandt werde. Erst der seit 1526 in Safed in Galiläa wirkende Rabbiner Josef ben Ephraim Caro, der bedeutendste sefardische Gelehrte der Zeit, erkannte in seinem zu allgemeiner Gültigkeit gelangenden Kompendium Schulchan Aruch („Der Gedeckte Tisch“) an, daß es dem Herrscher nicht verwehrt sei, neue, für die Juden geltende Gesetze zu erlassen. All diese Neuinterpretationen können als Beleg dafür genommen werden, daß sich die Juden in Europa einem starken Zwang zum Abbau der selbstauferlegten Schranken ausgesetzt sahen, dem sie allerdings nur zögernd folgen konnten, wenn sie ihre Identität behalten wollten.
Juden gab es in Europa seit der Spätantike, in Spanien und Italien zuerst, später an Marktorten und besonders den alten civitates im späteren Frankenreich. Die Begründung eines erneuerten römischen Kaisertums durch Otto den Großen 962 mit dem Anspruch einer das gesamte christliche Europa umfassenden Universalgewalt ließ ältere Schutzpflichten über homines minus potentes, unter die seit karolingischer Zeit auch die Juden fielen, neu entstehen. Die Legende, im Jahre 982 habe ein Angehöriger der jüdischen Familie Kalonymos dem Kaiser Otto II. in einer Schlacht das Leben gerettet, belegt das Bewußtsein einer von Anfang an bestehenden engen Verbindung der Juden zum Kaisertum.
Spätestens seit dem 9. Jahrhundert bildeten sich durch Zuwanderung aus unterschiedlichen Richtungen an den großen Handelswegen die ersten größeren jüdischen Gemeinden. Es waren dies Kaufmannskolonien, welche die sich nun bietenden ökonomischen Chancen sich zunutze machen wußten. Neben vielen teilweise älteren südfranzösischen Zentren – zu nennen sind Limoges, Orléans, Rouen, Reims und Troyes – gab es solche Ansiedlungen und bald auch Gemeinden in Metz, Mainz, Magdeburg, Merseburg, Worms, Regensburg und Köln, zu denen sich im 11. Jahrhundert Trier, Speyer, Aachen, Bamberg, Bonn, Heilbronn, Neuss, Prag und Xanten gesellten.
Mit der Neuansiedlung von Juden im ottonisch-salischen Reich setzte eine wirtschaftliche Neuorientierung ein. Waren die Juden der fränkischen Zeit meist Kaufleute, die sich um die Versorgung der herrschaftlichen Pfalzen bemühten, so wurden sie nun als Händler in den Städten ansässig, wo sie vielfältigere Geschäftskontakte anknüpfen konnten [↗ Handel]. Neben den weiterbestehenden Transithandel mit Seide, Gewürzen, Pelzen und Medikamenten trat nun über die Messen und Märkte die Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Rohstoffen, Nahrung, Metallen, Wein, Getreide, Vieh und Kleidung. Ergänzend zum Messegeschäft entwickelte sich das Kreditund Geldwechselgeschäft [↗ Geld]. Die Geschäftsform der ma’arufia, einer von der örtlichen Gemeinde anerkannten Alleinberechtigung eines jüdischen Kaufmanns bei seinen nichtjüdischen Partnern, und auch die Praxis der Darlehensaufnahme bei Nichtjuden zu Handelszwecken zeugen von einer zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtung mit der nichtjüdischen Umwelt.
Dem entspricht auch die Wohnweise: Keineswegs entstanden in sich abgeschlossene Ghettos, wie man lange Zeit geglaubt hat, sondern allenfalls Wohnviertel um einen kultischen Mittelpunkt, wie sie auch bei anderen Bevölkerungsgruppen üblich waren. Das um 1020 als iudeorum habitacula bezeichnete Regensburger Judenviertel, wie in Köln entlang der römischen Stadtmauer gelegen, ist in diesem Sinne zu verstehen – ein Viertel, in dem es auch christliche Häuser circumsita iudeis gab.
Die wohl schon von einem Kollegium der parnasim und einem Vorsteher geleiteten kehilot (Gemeinden) des aschkenasischen Siedlungsraums erfüllten von Beginn an im Kern kultischreligiöse Aufgaben. Viele von ihnen entwickelten sich zugleich zu Zentren rabbinischer Gelehrsamkeit [↗ Bildungseinrichtungen]. Schon im 11. Jahrhundert gab es Synagogen mit Lehrhäusern (jeschiwot) in Mainz, Köln, Speyer und Worms. Die Mainzer jeschiwa des Talmudgelehrten Gerschom ben Jehuda mit dem Beinamen Meor ha-Gola, „Leuchte des Exils“, war die bedeutendste dieser Zeit. In vielen, auf Anfrage vieler deutscher, französischer und italienischer Judengemeinden erteilten Responsen und takkanot („Statuten“) versuchte Gerschom, wie andere Rabbinen seiner Zeit, von dort aus die religiösen Grundsätze des Judentums mit den ethischen Erfordernissen des Lebens in Europa in Übereinstimmung zu bringen. Andere, wie Meschullam ben Kalonymos und Simon der Große in Mainz, auch der Wormser Vorbeter Meir ben Isaak, wurden um die gleiche Zeit durch ihre mystischen und liturgischen Dichtungen (pijutim) berühmt. Der in Worms aufgewachsene und später in Troyes lehrende Salomo ben Isaak gen. Raschi erlangte nachhaltigen Ruhm durch seinen Perusch Raschi, eine vereinfachende, leicht verständliche Zusammenfassung der aschkenasischen Tradition. Noch im 13. Jahrhundert hob Isaak ben Mose gen. Or Sarua aus Wien rühmend hervor: „Von unseren Lehrern in Mainz, Worms und Speyer ist die Lehre ausgegangen für ganz Israel, und seitdem Gemeinden in den Rheinlanden, in ganz Deutschland und in unseren Königreichen gegründet sind, hat man sich daselbst an ihre Vorschriften gehalten.“
Die Beziehungen der Juden zur christlichen Herrschaft – zu Kaiser und Papst als Vertretern der beiden Universalgewalten ebenso wie zu regionalen Funktionsträgern – waren am beiderseits anerkannten Paradigma der Schutzherrschaft orientiert. In Privilegienbriefen von 1090, die durchaus auf halachisches Recht Rücksicht nahmen, erteilte Heinrich IV. den Juden der Gemeinden von Speyer und Worms, kurz danach auch denen von Regensburg, zahlreiche Rechte. Danach durfte z.B. niemand ihr Vermögen beeinträchtigen. Sie sollten innerhalb des Reiches ungehindert Handel treiben können, ohne dafür Zölle entrichten zu müssen. Den Wormser Juden wurde darüber hinaus der Geldwechsel in eigenen Wechselstuben gestattet. In Rechtsstreitigkeiten mit Christen sollte jede Partei nach ihrem Gesetz Recht geben und ihre Sache beweisen. Innerjüdische Konflikte sollten von den Juden selbst geregelt werden. Für Worms wurde zusätzlich bestimmt, daß der Ortsbischof und seine Amtsträger in rechtlichen Angelegenheiten nur mit denjenigen unter den Juden verhandeln sollten, deren Wahl vom Kaiser legitimiert worden war, da sie „zur kaiserlichen Kammer gehörten“ (ad cameram nostram attineant). Mit dieser Formel, die ähnlich später im Rheinfränkischen Landfrieden Friedrich Barbarossas von 1179 Verwendung fand (iudei, qui ad fiscum imperatoris pertinent), wurde, noch ohne negative Konnotation, die kaiserliche „Kammerknechtschaft“ der Juden vorgebildet, wie sie mutatis mutandis auch in den Königsherrschaften England und Frankreich üblich war [↗ Königsherrschaft].
Nach sich wiederholenden Verfolgungen im 11. und 12. Jahrhundert im Zusammenhang mit Kreuzzügen [↗ Kreuzzüge] kam es im Hochmittelalter zu einer gewissen Stabilisierung und Vervielfältigung jüdischen Lebens. Von zahlreichen Hochadeligen wurden Juden zu Münzprägungen, zu Zoll- und Steuerverwaltungen sowie zur Finanzierung ihrer politischen Vorhaben herangezogen. Hinzu kamen der Handel mit verfallenen Pfändern, mit Wein sowie das Darlehensgeschäft.
Dem wirtschaftlichen Aufstieg und dem Zuwachs an Ansehen entsprach im Bereich des römisch-deutschen Reiches ein stärkeres Bewußtwerden der eigenen Potenz. Nach Loslösung von den Synoden von Troyes und Reims bildeten die drei führenden jüdischen Gemeinden Speyer, Worms und Mainz als sog. SCHUM-Gemeinden (nach den hebräisch transliterierten Anfangsbuchstaben) eine Art Bündnis zur Veranstaltung gemeinsamer Tagungen, mit dem Anspruch, dort allgemeinverbindliche takkanot (Statuten) für alle Juden des Reichs zu erlassen. Auf Tagungen der Jahre 1150, 1223 und 1250 wurden Regeln über gerichtliche Zuständigkeiten der SCHUM-Gemeinden aufgestellt, die aber angesichts der fortbestehenden Gemeindeautonomie nicht dauerhaft durchgesetzt werden konnten.
Diese takkanot wie auch andere innerjüdische Normen der Zeit lassen veränderte Konturen der jüdischen Familie und Hausgemeinschaft erkennen. Die seit dem Frühmittelalter nicht mehr praktizierte polygame Ehe war schon von Gerschon ben Jehuda verboten worden. Damit einher ging eine so bisher nicht bekannte Hochschätzung der Frau und das Verbot der Gewalt ihr gegenüber [↗ Lebensstände – Mann und Frau]. Durch die häufigen Geschäftsreisen des Ehemanns wuchs sie in die Rolle der Geschäftsführerin hinein, durch die ihre gesellschaftliche und auch rechtliche Stellung mehr und mehr gestärkt wurde. Dem entspricht, dass die im Falle der Scheidung oder Verwitwung zu zahlende Abfindung (ketuba) auf die enorm hohe Einheitssumme von 100 Pfund festgelegt wurde, im späteren 14. Jahrhundert mit dem Äquivalent von 600 Gulden berechnet. Der Praxis entsprach allerdings nicht die Auszahlung, sondern die Übertragung des Familien- und Geschäftsvermögens. Da beim Eheschluß der von der von der Brautfamilie zu zahlenden Mitgift eine „Widerlegung“ durch die Eltern des Bräutigams in gleicher Höhe entsprach, war das Ehe- und Erbrecht der Juden im Mittelalter von einer funktionellen Gegenseitigkeit und einer Gleichheit zwischen den Geschlechtern geprägt. Überdies ließ spätestens seit dem 13. Jahrhundert das jüdische Recht ein selbständiges Auftreten der Frau vor Gericht zu, und zwar ohne die im christlichen Recht übliche Geschlechtsvormundschaft. Bei Übernahme des vom Manne betriebenen Geschäfts konnte sich die Ehefrau deshalb folgerichtig auch nicht auf einen Haftungsausschluß berufen, da sie ja schon vorher verantwortlich im Geschäft mitgewirkt hatte.
Ein weiteres Kennzeichen der jüdischen Gesellschaft war ihre solidarische Grundausrichtung. Dies läßt sich an den vielfältigen Ausprägungen der Wohltätigkeit (zedakka) erkennen, wie an der Armenfürsorge, dem Gebot zur Auslösung Gefangener und dem Einsatz für verfolgte und bedrängte Gemeinden. Diese ausgeprägte Solidarität – öfters mit den Worten, daß „ganz Israel füreinander verantwortlich ist“, ausgedrückt – war ein gewisses Äquivalent dafür, daß die im Mittelalter entstandene Gemeindeautonomie durch den Druck der christlichen Umwelt einer gewissen Gefährdung ausgesetzt war. Insbesondere bedurfte es eines Instruments zur Einbindung potenter „Hofjuden“ als Fürsprecher (schtadlan), da befürchtet wurde, daß diese auf Kosten der Gemeinde Vorteile erlangten und damit zu deren Gefährdung beitrugen. Die bald als „heilig“ hypostasierte Gemeinde blieb dennoch bis zum Ende des Mittelalters die entscheidende organisatorische Einheit jüdischen Lebens.
Das urbane Leben der Juden des römischdeutschen Reiches, umgeben von der Umwelt der gojim, paßte sich den veränderten Gegebenheiten an. Standen im Frühmittelalter noch die verschiedenen städtischen Gruppen im Rahmen einer offenen Verfassung relativ unverbunden einer königlichen bzw. bischöflichen Stadtherrschaft gegenüber, so vollzog sich hier seit dem 12. Jahrhundert ein Wandel. Nach dem Vorbild der oberitalienischen Kommunen begannen die städtischen Bürger unter Führung von Patriziern ein neues Gemeinschaftsbewußtsein zu entwickkeln, das auch Abgrenzungen und Zuordnungen innerhalb der Gesellschaftsordnung mit sich brachte [↗ Genossenschatliche Ordnungen]. Eine Konsequenz daraus war, daß die Juden nun ihre Stellung im urbanen Umfeld neu definieren mußten. Dies führte einerseits zu einer normativen Annäherung bis hin zu einer concivitas im Verhältnis zu den christlichen Bürgern, zur Partizipation an gemeinsamen Rechten und Lasten („Judenbürgerschaft“); andererseits kam es zu einer gewissen Marginalisierung, da Juden dem Schwurverband der christlichen Gemeinde nicht angehören konnten und damit außerhalb der neuen Organisationsstrukturen standen. Die latente Gefahr einer Exklusion bestand um so mehr, als seit dem 11. Jahrhundert von den Bischöfen Burchard von Worms und Ivo von Chartres die alte patristische Konstruktion einer servitus perpetua iudaeorum als einer Rechtsfolge der Erbsünde („Schuld am Tode Christi“) in den Normenkanon des Kirchenrechts aufgenommen wurde. Dies führte zu einer „Verrechtlichung“ der jüdisch-christlichen Beziehungen im Sinne einer minderen, abhängigen Rechtsstellung der Juden.
Eine Gefahr drohte den Juden von den erstmals 1144 in Norwich und danach in mehreren französischen Städten verbreiteten Vorwürfen des Ritualmords an christlichen Kindern. Seit 1221 hatten derartige Beschuldigungen im Heiligen Römischen Reich Nachahmung gefunden und führten zu Verfolgungen. Zu Ausschreibungen war es 1235 in Lauda, Tauberbischofsheim und Fulda gekommen. Der Fuldaer Fall, der mit der Ermordung aller 32 Gemeindeglieder endete, wurde an das Hofgericht Kaiser Friedrichs II. gebracht und führte dort 1236 zu einem (postumen) Freispruch der Juden, da die Juden nach den Lehren des Alten und Neuen Testaments keinen Durst nach Menschenblut haben könnten. Gleichzeitig erteilte Friedrich II. auf dem Augsburger Hoftag dieses Jahres den Juden des Reichs unter Bestätigung des 1157 von Barbarossa den Wormser Juden erteilten Freiheitsbriefs ein umfassendes Privileg. Die Juden wurden nun allgemein in den Schutz des Kaisers gestellt, dessen Kammer sie als Sklaven zugehörten (universi Alemannie servi camere nostri). Ergänzend wurde in einem 1237 der Stadt Wien erteilten Privileg die „Kammerknechtschaft“ der Juden damit begründet, daß diese von öffentlichen Amtsgeschäften ausgeschlossen werden sollten, weil sie seit alters zur Buße für ihre Verbrechen zu ewiger Knechtschaft verdammt seien. Damit wurde die im Liber Extra von 1234 stereotypisierte Begründung übernommen. Dies geschah offensichtlich zur Legitimierung der kaiserlichen Schutzgewalt in Auseinandersetzung mit Kirche und Papst. Eine Rechtsminderung war damit nicht beabsichtigt.
Seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts begannen sich die Rahmenbedingungen für die Juden in Europa zu verschlechtern. Der Vertreibung in England 1290 folgten in Frankreich zahlreiche Verfolgungen und Exklusionen, die 1394 endgültig mit der Ausweisung aller Juden aus dem Reich Karls VI. endeten. Neue jüdische Siedlungen entstanden in Italien und vor allem aufgrund günstiger Privilegien in Polen. Die anfangs noch wenig beachteten Beschlüsse des 4. Laterankonzils von 1215, die eine konsequente Trennung christlicher und jüdischer Lebensbereiche forderten, wurden 1267 durch Beschlüsse einer Breslauer Synode wiederholt und verfestigt. Zugleich wurde das kirchliche Recht im römischdeutschen Reich umfassender als bisher rezipiert. Schon 1275 hatte König Rudolf die sogenannte Sicut Judaeis-Bulle, die erstmals 1120 formuliert und immer wieder von Päpsten neu verkündet worden war, als geltendes Reichsrecht rezipiert. Damit wurde die augustinische Lehre vom minderen, aber erhaltenswerten Status der Juden in kaiserliches Recht umgesetzt. Die Juden waren seither Gegenstand des Judenregals, nachdem sie als nutzbare Objekte behandelt wurden, zu deren Schutz der Kaiser zwar verpflichtet war, die er aber an andere „Schutzherren“ weiterverleihen konnte [↗ Regalien]. Auch nach der in der Summa Theologiae des Thomas von Aquin verfestigten scholastischen Lehre waren die Juden infolge ihrer eigenen Schuld am Tode Christi den jeweils herrschenden Fürsten zu ewiger Knechtschaft unterworfen. Dies alles führte zur Umdeutung der alten „Kammerknechtschaft“, die nun vor allem als Berechtigung zur intensiven Besteuerung verstanden wurde. Der Einführung des sogenannten „Goldenen Opferpfennigs“ durch Ludwig den Bayern 1342 (bestätigt von Karl IV. 1347) folgte, namentlich in der „Goldenen Bulle“ von 1356, die Weitergabe des aus der Kammerknechtschaft abgeleiteten Judenregals an die Kurfürsten und nach und nach an die meisten Landesfürsten.
Der Relativierung der kaiserlichen bzw. königlichen Schutzgewalt in den mitteleuropäischen Ländern entsprach die Zunahme des Gefährdungspotentials für die Juden selbst. Die von Röttingen an der Tauber ausgehenden „Rintfleisch-Verfolgungen“ 1298 mit über 5.000 in „Memorbüchern“ festgehaltenen Morden an Juden mögen in der Schwäche der Reichsgewalt ihre Ursache gehabt haben. Weitere Ausschreitungen („Armleder-Verfolgungen“) um Arnold von Uissigheim in den Jahren 1336 bis 1338 basierten weitgehend auf dem neu entstandenen Vorwurf des Hostienfrevels. Gleichzeitig kam – erstmals in Savoyen – der Vorwurf der Brunnenvergiftung, um damit die Juden als Schuldige für die allenthalben ausbrechenden Seuchen brandmarken zu können. Von 1348 bis 1350 wurden mit Billigung König Karls IV. nahezu 100 jüdische Gemeinden im römisch-deutschen Reich zerstört und deren Mitglieder ermordet oder vertrieben.
Zwar begann sich in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts jüdisches Leben wieder zu entwickeln; jedoch hatten die Verfolgungen ein Trauma hinterlassen und das Bewußtsein der Juden und das Selbstverständnis der jüdischen Gemeinden nachhaltig verändert. Neben die – vielfach an anderer Stelle in den Städten – reaktivierten alten Gemeinden traten neue, die nicht mehr mit dem gleichen Selbstbewußtsein wie in der älteren Zeit gegenüber ihrer christlichen Umwelt auftreten konnten. Schutz- und Geleitsbriefe wurden nun in der Regel an einzelne Juden bzw. deren Familien gegen Auferlegung bestimmter Schutzgelder, die Begrenzung von Handel und Gewerbe sowie die Festlegung der Wohnung erteilt. Gemeinden bildeten sich nicht mehr kraft herrschaftlichen Privilegs, sondern nur dann, wenn die erforderliche Anzahl von zehn volljährigen Personen (minjan) zusammenkam. Nur selten kam es, wie in Frankfurt 1462, zu einer von der Stadtobrigkeit erzwungenen ghettoartigen Abschließung. Immerhin konnten für die Zeit bis zum beginnenden 16. Jahrhundert über 1.000 Orte identifiziert werden, an denen Juden – innerhalb oder außerhalb einer Gemeinde – ansässig wurden; nur die Hälfte von ihnen folgten älteren Siedlungen. Schon um 1400 lag die Gesamtzahl der jüdischen Haushalte bei 7.000 bis 8.000 Haushalten, hatte aber damit allenfalls die Hälfte des Niveaus der Zeit vor den Pogromen erreicht. Hier machten sich die Migrationen in Richtung Italiens, Polen-Litauens und auch in den Balkan bemerkbar.
Neben dem weiterhin dominierenden, aber auf kleinere Dimensionen geschrumpften Geldhandel betätigten sich Juden seither vor allem in Dienstleistungsberufen innerhalb der eigenen Gemeinde. Sie waren Rabbiner, Vorsänger, Schulklopfer, Synagogendiener und Schreiber, aber auch Schächter und Bäcker. Hinzu kam die Berufsgruppe der Ärzte, Tierärzte, Apotheker und Hebammen. Im Warenhandel war der Vieh-, Wein- und Pferdehandel dominierend, daneben der Handel mit Gebrauchtwaren, mit Luxusgütern und Mobiliar. Eher vereinzelt sind gewerbliche Betätigungen nachweisbar, da die christlichen Zünfte exklusive Zuständigkeiten beanspruchten [↗ Handwerk]. Dennoch gab es einige wenige jüdische Schuster, Sattler, Weber, Schneider, Goldschmiede und Schwertfeger, außerdem Maler, Spielkarten- und Würfelmacher, Brauer, Branntweinbrenner, Drechsler, Maurer und Glaser. Für das Bild der Juden in der christlichen Gesellschaft waren indes die Geld- und Pfandleiher entscheidend.
Seit dem 15. Jahrhundert begannen die römisch-deutschen Kaiser und Könige damit, sich der Juden als einer königsnahen Gruppe zu versichern und sie nachhaltiger als bisher für eigene politische und fiskalische Zwecke zu instrumentalisieren. Hatte die repressive Finanzpolitik der Luxemburger Karl IV. und Wenzel im 14. Jahrhundert zu einer Minimalisierung des verfügbaren Steuerkapitals der Juden geführt – bedingt vor allem durch die von Wenzel zur Sicherung seiner Königsherrschaft 1385 und 1390 verfügten „Judenschuldentilgungen“ zu Lasten der jüdischen Gläubiger –, so standen jetzt Maßnahmen im Vordergrund, die Folgen der Territorialisierung des Judenregals rückgängig zu machen. Die Einsetzung von jüdischen Hochmeistern durch die Herrscher seit König Ruprecht, der Erlaß einer Judenordnung 1415 durch König Sigmund und die Normierung des Rechtswegs an die Reichsgerichte für Juden durch Kaiser Friedrich III. 1470 waren Schritte zur Neubegründung einer reichsunmittelbaren Stellung der Juden im Reich. Begleitet wurden diese Maßnahmen durch eine sukzessive Ausweitung der Steuerlasten, wie besonders der Einführung einer Krönungssteuer seit König Sigmund – damit begründet, daß der König an sich berechtigt sei, bei seiner Krönung allen Juden Gut und Leben zu nehmen, sofern er eine gewisse Anzahl unter ihnen zum ewigen Gedächtnis und zum Zeugnis der Wahrheit der Heilsgeschichte erhalte. Für die Ablösung dieser Last sollten demnach Steuern gezahlt werden.
Die seit dem späten 14. Jahrhundert immer prekärer werdende Situation der Juden im Reich – ganz ebenso wie in Frankreich –, gleichzeitig aber auch die zunehmende Prosperität der Städte, die sich vom Aderlaß des „Schwarzen Todes“ erholt hatten, ließ bald das Gefühl aufkommen, daß die Juden entbehrlich seien. Bestärkt sah man sich durch die Agitation der Bettelordensprediger in den Städten und die Dekrete des Kardinallegaten Nikolaus von Kues von 1451, nach denen die Bestimmungen des 4. Laterankonzils wieder in Erinnerung gerufen und erneuert wurden. Ritualmordvorwürfe, wie der von Trient 1475, schufen bald eine Atmosphäre, die auch das gesellschaftliche Leben der Juden erschwerte. So wurden nach und nach im 15. Jahrhundert bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts die Juden aus fast allen bedeutenderen Städten des Reichs vertrieben. Nach einer frühen Vertreibung in Basel 1397 folgten 1424/25 Köln, Freiburg und andere vorderösterreichische Städte, 1439 Augsburg, 1455 Breslau, 1473 Mainz und 1499 Ulm. Die letzte größere Judenausweisung fand 1519 in Regensburg statt. Hier führten trotz Einspruchs Kaiser Maximilians I. die ab 1516 wirksam werdenden Predigten des Dompredigers Balthasar Hubmaier zur Vertreibung, zum Abriß der Synagoge und zu deren Ersetzung durch eine Wallfahrtskirche.
Das Beispiel der Städte machte bald auch in den Territorien Schule. Unter ihnen machten 1442/1450 die bayerischen Herzöge den Anfang; in den siebziger Jahren folgten die Bistümer Mainz, Bamberg und Passau, bis schließlich 1490 mit den Erzstiften Magdeburg und Salzburg, den Herzogtümern Steiermark, Kärnten und Krain sowie Mecklenburg und der Markgrafschaft Brandenburg weite Teile des Reiches erfaßt waren.
Obwohl die meisten Austreibungen selten so rigoros durchgeführt wurden, daß alle Juden das Land verlassen mußten, ist doch davon auszugehen, daß ein beträchtlicher Teil der Juden des römisch-deutschen Reiches auswandern musste. Die Abwanderung eines weiteren Teils der Juden in Dörfer und Kleinstädte brachte den schon lange vorher angelaufenen Prozeß der De-Urbanisierung der römisch-deutschen Judenschaft zum Abschluß. Bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts war das vormals vorwiegend urbane Judentum zu einem marginalen Faktor geworden.
J. FRIEDRICH BATTENBERG