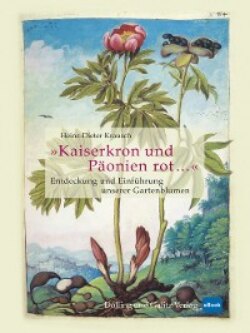Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCampsis radicans (L.) Seem. Trompetenwinde
Der in den östlichen Vereinigten Staaten von New Jersey bis Iowa und südlich bis Florida und Texas heimische Wurzelkletterer aus der Familie der Bignoniaceae kam um 1620 aus den damaligen französischen Kolonien in Nordamerika nach Paris. Erstmals wurde er dort 1623 von Jean und Vespasian Robin in deren Enchiridion isagogicum als Clematis virginiana sive Jasminum Americanum aufgeführt. 1635 beschrieb ihn Jacques Cornut in seinem Buch über kanadische Pflanzen unter dem Namen Gelseminum hederaceum indicum und brachte auch eine erste Abbildung. Von Paris aus gelangte die Pflanze alsbald auch in andere Gärten Europas. 1633 war sie in Leiden und in Florenz vorhanden, 1634 in Lambeth (England), hatte dort aber bis um 1640 noch nicht geblüht. Bald darauf kam die Trompetenwinde auch nach Deutschland, zuerst wohl zwischen 1630 und 1651 in den herzoglich braunschweigischen Garten zu Hessem, wo sie 1651 als Clematis virginiana aufgeführt wurde. 1646 wuchs sie aber auch schon im Botanischen Garten der damaligen Universität Altdorf bei Nürnberg, wohin sie wahrscheinlich aus Padua gekommen war, wo sie seit 1642 nachweisbar ist. 1655 wurde sie als Clematis virginiana im herzoglich schleswigschen Garten zu Gottorf kultiviert, und 1663 finden wir die Trompetenwinde in der Mark Brandenburg. Die damals erschienene Flora Marchica von Johann Sigismund Elsholtz nennt sie Clematitis Indica flore phoeniceo, »Indianische Waldrebe«. Im Gartenbaubuch desselben Verfassers (1684) heißt es dann, dieses Gewächs sei »wegen seiner hochrothen Blumen angenehm worden«. Man hielt es damals nicht für winterhart, und so führte es Elsholtz im Abschnitt »Schirm=Gewächß von Blumwerck« auf und schreibt, es erfordere »einen wol besonneten Ort im Pomerantzen=Hause an einer Wand/daran man ihm ein Gelender von Latten/an welchem es seine Zweige frey ausbreiten möge/auffrichten muß«. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Art in Europa ständig weiter vermehrt und weitergegeben, und Mitte des 18. Jhs. gab es kaum noch einen Botanischen Garten oder Liebhabergarten, in dem die Trompetenwinde nicht vorhanden war.
Goethe lernte sie 1786 auf seiner Italienreise im Botanischen Garten von Padua kennen; dort machte sie, wie er später schrieb, »einen solchen Eindruck auf mich, daß ich dieser Pflanze besonders gewogen blieb und, wo ich sie in Botanischen Gärten antraf, in den Weimarischen Anlagen, wo sie mit Neigung gepflegt ward, auch im eigenen Garten immer mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtete«.
1699 wurde die Trompetenwinde im Katalog des Boseschen Gartens in Leipzig als Clematis Indica, flore phoeniceo aufgeführt. Zu dieser Zeit erkannte man jedoch, daß sie weder ein Jasmin noch eine Waldrebe war, und so begründete Tournefort für sie den Gattungsnamen Bignonia, benannt nach Abbé Jean Paul Bignon (1662–1743), Bibliothekar Ludwigs XIV. Linnaeus übernahm diesen Gattungsnamen und nannte die Art Bignonia radicans. Im 19. Jh. stellte man sie zunächst zu der von Antoine Laurent Jussieu 1789 geschaffenen Gattung Tecoma. Als Tecoma radicans wurde die Trompetenwinde 1855/56 von der Landesbaumschule Potsdam zum Verkauf angeboten, das Schock zu 8 Reichstaler 10 Silbergroschen. Später erkannte der aus Hannover stammende Botaniker Berthold Seemann, daß die Art in die bereits 1790 von dem portugiesischen Jesuiten Juan Loureiro begründete Gattung Campsis gehört, deren Name zu griechisch kámpsis, »Biegung, Krümmung«, nach den an der Spitze gekrümmten Staubfäden, gebildet wurde. Heute kultiviert man die Trompetenwinde in Deutschland vielfach als Park- und Gartenpflanze, wobei sie in sommerwarmen Gebieten deutlich häufiger ist. Von ihr gibt es seit langem mehrere Sorten, u.a. mit dunkelroten bzw. scharlachroten Blüten.
Als weitere Campsis-Art wurde Anfang des 19. Jhs. die in China und Japan heimische, 1775 von Thunberg entdeckte C. grandiflora (Thunb.) K. Schum. (= C. chinensis (Lam.) K. Koch) eingeführt, welche schöner, aber auch viel empfindlicher ist und daher nur als Kalthauspflanze gezogen werden kann. Zwischen ihr und C. radicans entstand 1889 der Bastard C. x tagliabuana (Vis.) Rehd.