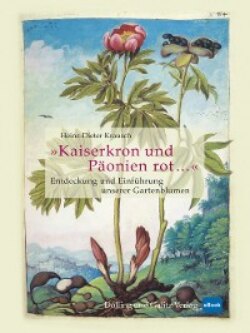Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCentaurea L. Flockenblume
Centaurea montana L. Berg-Flockenblume, Matthiolus/Bauhin 1598
Von den rd. 500 Arten der Gattung Centaurea sind nur wenige zu Gartenblumen geworden. Zu den einjährigen Arten gehört die allbekannte Kornblume (C. cyanus L.). In der Späteiszeit wuchs sie auch in Mitteleuropa in baumfreien Tundren- und Steppengebieten. Als sich diese dann im Verlaufe der weiteren Entwicklung wieder mit Wald überzogen, wurde ihr Heimatareal auf das östliche Mittelmeergebiet und Westasien beschränkt. Von dort kam sie in der Jüngeren Steinzeit zusammen mit den Getreide-Arten und deren Unkräutern als Archäophyt auch wieder nach Mitteleuropa. Hier war sie dann Jahrtausende hindurch ein weit verbreitetes und überall häufiges Wildkraut der Wintergetreidefelder. Erst die Gegenwart hat die Kornblume durch den Einsatz von Herbiziden vielerorts zu einer Seltenheit werden lassen. Ihre leuchtend blauen Blüten haben seit jeher die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich gezogen, und auch die Artbezeichnung cyanus (zu gr. kyanós, »blau«) geht darauf zurück. So ist die Kornblume seit altersher gut bekannt und wird bis heute gern zu Sträußen gepflückt. Schon frühzeitig, mindestens jedoch im späten Mittelalter, holte man sie als Zierpflanze in die Gärten, insbesondere die in der Natur seltenen Farbabweichungen mit weißen und rötlichen Blüten. Derartige Gartenformen kannte bereits Hieronymus Bock (1539). Er schreibt dazu: »Dise blumen zielen [ziehen] die Jungfrawen inn den gärten/außgenommen die blawen findet man inn allen Früchten wachsen.« Aber auch die blaue Form war damals Gartenpflanze. So nennt sie Gessner in seinen Horti Germaniae Cyanus coeruleus, puniceus, albus (blau, purpurrot, weiß) und vermerkt, die Art werde in den meisten Gärten gezogen. Im fürstbischöflichen Garten von Eichstätt gab es 1613 bereits 7 verschiedene Farbsorten: blau, fleischfarben, weiß, purpurrot, rot, rosa/weiß und weiß mit purpurnem Rand. Später kamen noch weitere Farbformen (z.B. weiß/blau, rosa/rot) hinzu. Man nannte diese Gartensorten geradezu Cyanus hortensis. Seit dem Ende des 16. Jhs. sind auch gefüllte Formen bekannt. Zuerst werden sie von Tabernaemontanus (1588) erwähnt. Zunächst noch recht selten, gelangten sie im Laufe des 17. Jhs. zu weiter Verbreitung. Bis zur Gegenwart ist die Kornblume mit ihren zahlreichen Gartenformen eine beliebte Sommerblume geblieben. Sie wird heute meist als Farbmischung angeboten und an Ort und Stelle ausgesät. Als Lieblingsblume des preußischen Königs und späteren deutschen Kaisers Wilhelm I. avancierte sie im vorigen Jh. in Preußen zum Symbol des Royalismus. Königstreue Untertanen pflegten an Kaisers Geburtstag und an Staatsfeiertagen eine Kornblume im Knopfloch zu tragen, was den Spott des alten Theodor Fontane hervorrief: »Es ist eine lederne Blume, bloß blau, ohne Duft, ohne Schönheit, ohne Poesie, so recht wie geschaffen für uns, irgendwo müßte sie noch einen roten Hosenstreifen haben.«
Zu den in der Gattung Centaurea überwiegenden ausdauernden Arten zählt die Berg-Flockenblume (C. montana L.), welche in den höheren Gebirgslagen in Mittel- und Südeuropa sowie in Kleinasien zu Hause ist. Wegen ihrer schönen blauen Blüten in die Gärten geholt, erscheint sie zuerst 1554 als Zierpflanze. 1560 war sie bereits in vielen Gärten vorhanden, und man nannte sie damals Cyanus exoticus, C. montanus und C. sylvaticus. Ende des 16. Jhs. kannte man neben der Stammform eine Gartenform mit weißen Blüten. Bis heute gehört diese Art, nicht zuletzt auch wegen ihrer Anspruchslosigkeit und Wüchsigkeit, zu den beliebten und häufigen Gartenblumen. Seit dem 19. Jh. entstanden durch Auslesezüchtung verschiedene größer- und reicherblütige Sorten mit leuchtend blauen, dunkelvioletten, weißen, rosa und purpurlavendelfarbenen Blüten, doch ist auch die alte Urform noch häufig zu sehen.
Zu diesen in Mitteleuropa heimischen Flockenblumen gesellten sich seit Anfang des 19. Jhs. einige Arten aus dem Kaukasus. Die Rotweiße Flockenblume (C. dealbata Willd.) mit blaßpurpurroten, in der Mitte weißlichen Blüten wurde 1701 von Tournefort in Iberien, dem heutigen Georgien, gefunden und 1703 von ihm als Cyanus orientalis Artemisiae foliis beschrieben, kam damals aber nur als Herbarexemplar nach Europa. Kurz nach 1800 gelangten dann auch lebende Pflanzen nach England und Deutschland, und durch den damaligen Direktor des Berliner Botanischen Gartens, Carl Ludwig Willdenow erfolgte 1803 die heute gültige Namengebung. 1808 wuchs die Art im Berliner Botanischen Garten, von wo aus sie sich dann relativ rasch in den deutschen Gärten ausbreitete. 1817 wurde sie in Leipzig gezogen, 1824 in Frankfurt/Oder, und 1837 erwähnt sie auch der österreichische Pfarrer Johann Theophil Zetter in seinem Staudenbuch als empfehlenswert. Heute gibt es neben der Stammform noch die durch Auslese entstandene Sorte ‘Steenbergii’ mit prächtig karminpurpurnen Blütenköpfen. Von der dieser Art sehr nahestehenden C. hypoleuca DC. kam um 1900 die Sorte ‘John Coutts’ mit noch größeren rosaroten Blütenköpfen aus England nach Deutschland und ist seitdem ebenfalls in Gärten vorhanden, wenn auch längst nicht so häufig wie C. dealbata.
Als dekorative Hochstaude mit gelben Blüten breitet sich in den letzten Jahren mehr und mehr die Großköpfige Flockenblume (C. macrocephala Puschkin ex Willd.) in den deutschen Gärten aus. Auch diese Art ist 1701 von Tournefort entdeckt und 1703 von ihm als Centaurium maius orientale Helenii folio beschrieben worden. Kurz nach 1800 wurde sie dann auch auf der Kaukasusexpedition des russischen Geologen Graf Mussin-Puschkin (gest. 1805) gefunden. Von ihm erhielt Willdenow die Pflanze unter dem Namen C. macrocephala und beschrieb sie sogleich als neue Art. Eigentlich geht ihr Name auf den deutschen Botaniker Johann Friedrich Adam zurück, welcher den Grafen von Mussin-Puschkin auf seiner Forschungsreise begleitete, doch ist dessen im Herbst 1802 in Tiflis verfaßte Abhandlung über neue Pflanzenarten des Kaukasus und Georgiens erst 1805 in Kiel im Druck erschienen. Ebenso wie C. dealbata wuchs die Art bereits 1808 im Botanischen Garten Berlin und breitete sich von dort aus in ähnlicher Weise aus, blieb aber seltener und stärker auf Botanische Gärten und Gärten von Staudenfreunden beschränkt.