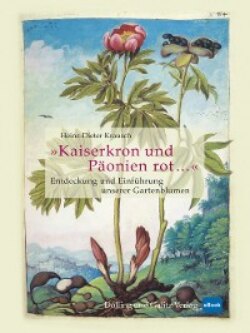Читать книгу »Kaiserkron und Päonien rot…« - Heinz-Dieter Krausch - Страница 58
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеClematis L. Waldrebe
Von den 10 im südlichen Europa heimischen Clematis-Arten reichen die Gemeine Waldrebe (C. vitalba L.) und die Aufrechte Waldrebe mit ihren Arealen bis in das südliche Deutschland hinein. Über die erstere heißt es 1543 bei Fuchs: »Deß gewechß, welches Lynen/oder Lenen heyßt/würt auch Waldreb genent«. Die Art wurde 1561 von Konrad Gessner unter dem Namen Vitis sylvestris caustica als Gartenpflanze aufgeführt, doch von den von ihm befragten Gartenbesitzern nur von Aemylius in Stolberg im Harz gezogen. Nach und nach breitete sich die Gemeine Waldrebe als Gartenpflanze weiter aus. Im 17. Jh. war sie z.B. 1613 im Hortus Eystettensis (Clematis sive Viorna vulgi Lobelii) und 1663 im Berliner Lustgarten (Clematitis sylvestris latifolia C. B.) vorhanden. Man verwendete die Art vor allem zur Bekleidung von Lauben. Im 19. Jh. war sie weit verbreitet, und auch heute noch ist sie mancherorts in dieser Funktion zu sehen. Vielfach ist die Gemeine Waldrebe auch verwildert und an Zäunen, Eisenbahndämmen und Straßenböschungen mitunter in Mengen eingebürgert.
Die Aufrechte Waldrebe (C. recta L.), eine nicht kletternde, bis 1,5 m hoch werdende Staude, heimisch in wärmeliebenden Buschwäldern und Säumen Südeuropas und des südlichen Mitteleuropas, war in Deutschland ebenfalls schon seit dem 16. Jh. in Gartenkultur. So erscheint sie z.B. als Flammula surrecta, »Brenwurtz/Blatterzug« in Frankes Hortus Lusatiae und ebenso im Hortus Eystettensis als Flammula recta. Eine ebenfalls staudige Art, aber mit blauvioletten Blüten, ist die von Südosteuropa bis Mittelasien vorkommende Ungarische Waldrebe (C. integrifolia L.). Erstmals beschrieb sie Clusius in seinem 1583 gedruckten Buch über die selteneren Pflanzen Österreichs und Ungarns als Clematis altera Pannonica flore coerulea (mit 2 Abbildungen) und gab dazu an, sie sei 1574 wildwachsend auf Wiesen am Donauufer bei Stampfen, 2 Meilen hinter Posonium, sowie zwischen Posonium und Tuben gefunden worden. Von Wien aus gelangte die Art in Gartenkultur. 1613 war sie unter dem Namen Clematis coerulea pannonica im fürstbischöflichen Garten zu Eichstätt und etwa zur gleichen Zeit als C. caerulea erecta Pannonica im herzoglich braunschweigischen Garten zu Hessem vertreten. Vom 17. bis zum 19. Jh. waren diese Arten ebenso wie die weißblütige und kletternde Mandel-Waldrebe (C. flammula L.) aus dem Mittelmeergebiet und Vorderasien offenbar ziemlich häufige Gartenpflanzen, sind jedoch in unseren heutigen Gärten kaum noch zu sehen.
Die Italienische Waldrebe (C. viticella L.) war als Gartenpflanze 1561 in Antwerpen vorhanden und kam bald darauf sowohl nach England, wo sie 1569 von dem Apotheker Königin Elisabeths I., Hugh Morgan, gezogen wurde, als auch nach Deutschland. 1586 bildete Camerarius sie als Clematis altera, an einem bogenförmigen Klettergerüst wachsend, im Epitome ab. Sie blieb aber vorerst selten. 1594 war sie als Clematis altera Dodonaei im Garten des Breslauer Arztes Laurentius Scholz vorhanden, fehlte aber noch in den Lausitzer Gärten. 1597 kultivierte man in England neben der blauvioletten eine rotblühende Form. Der Hortus Eystettensis (1613) enthält die violette und die rote Form (Clematis peregrina purpurea und incarnata), beide sowohl einfach (simplici flore) als auch gefüllt (flore pleno) blühend. In diesen Formen wurde die Art »ihrer Schönheit und der langandauernden Blüte halber von den Liebhabern in Lustgärten gerne erhalten«, besonders aber die gefüllte Form, »der man eine wärmere Lage und Schutz zu geben pfleget«, wie Gleditsch 1773 schreibt. Im 19. Jh. war die Italienische Waldrebe in Deutschland als Zierpflanze recht verbreitet und wurde vor allem zur Bekleidung von Lauben gezogen.
1850 brachte Robert Fortune eine von ihm auf den Hügeln bei Ningpo in Ostchina entdeckte, bisher unbekannte ostasiatische Waldreben-Art mit noch größeren blaugrauen Blüten nach England, die dort 1852 von John Lindley als C. lanuginosa, Wollige Waldrebe beschrieben wurde. Von englischen Gärtnern wurde diese neue Art sofort zur Züchtung verwendet. Zunächst zog Isaac Anderson-Henry in Edinburgh 1855 eine Hybride zwischen C. lanuginosa und der 1836 von Philipp Franz von Siebold aus Japan eingeführten C. patens C. Morr. et Decne., welche C. x reginae genannt wurde. Eingehend beschäftigte sich dann die Gärtnerei von George Jackman & Son in Woking (Surrey) mit der Clematis-Züchtung und erzielte als Ergebnis von Kreuzungen zwischen C. lanuginosa, C. viticella und der um 1835 entstandenen Hybride C. x hendersonii (C. integrifolia x C. viticella) 1862 die erste ihrer prächtigen Jackmanii-Hybriden. Durch intensive Zuchtarbeit, in die auch C. florida Thunb. aus China und einige weitere Arten einbezogen wurden und an der vor allem englische, aber auch einige französische und deutsche Züchter beteiligt waren, entstand eine Fülle großblütiger Clematis-Hybriden, welche die Ausgangsarten nahezu völlig aus den Gärten verdrängten. Der Schwerpunkt der Clematis-Züchtung lag im Zeitraum zwischen 1860 und 1880, doch kamen auch später noch weitere Sorten hinzu. Um 1975 waren gegen 500 Zuchtsorten bekannt, von denen viele jedoch nicht mehr existierten.
Neuerdings breitet sich neben den großblumigen, meist erst im Hoch- und Spätsommer zur Blüte kommenden Waldreben-Züchtungen die zwar kleinerblütige, aber besonders reich und bereits im Mai blühende Berg-Waldrebe (C. montana Buch.-Ham. ex DC.) in unseren Gärten aus. Diese im Himalaya und Mittel- und Westchina beheimatete Art wurde von Lady S. Amherst, der pflanzenliebenden Gattin des englischen Generalgouverneurs von Indien, im Himalaya entdeckt. Sie brachte 1828 Samen mit nach England, wo die Art dann angezogen und weiter verbreitet wurde. 1855/56 war die Berg-Waldrebe bereits im Angebot der Landesbaumschule Potsdam. Das Stück kostete 10 Silbergroschen und war damit viermal so teuer wie C. viticella. So recht beliebt wurde diese zunächst nur in einer weißblühenden Form vorliegende Art aber erst, nachdem der englische Pflanzensammler Henry Wilson von seiner ersten Chinareise 1902 die rosa blühende Form (rubens) nach England gebracht hatte. Dort von der Gärtnerei Veitch in Combe Wood bei London kultiviert und durch Auslese verbessert, gelangte sie alsbald auch nach Deutschland und stieß hier auf zunehmendes Interesse, so daß sie heute schon vielerorts in Gärten und an Hauswänden zu sehen ist, ein altes Exemplar z.B. am Verwaltungsgebäude des Botanischen Gartens in Leipzig.
Die seltener anzutreffende gelbblühende Mongolische Waldrebe (C. tangutica (Maxim.) Korsh.) aus dem Pamir-Gebiet und Nordwestchina wurde in den 1880er Jahren von dem russischen Botaniker Carl Johann Maximowicz entdeckt und 1889 in seiner Flora tangutica als C. orientalis var. tangutica beschrieben, von seinem Kollegen Sergej Ivanoviˇc Korshinsky (1861–1900) aber wenige Jahre darauf zu einer eigenen Art erhoben. Vom Botanischen Garten St. Petersburg kam die Art dann Ende des 19. Jhs. auch nach West- und Mitteleuropa. 1900 wurde sie im Botanical Magazine abgebildet und vorgestellt.