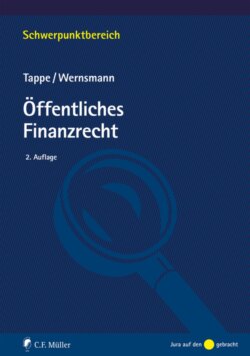Читать книгу Öffentliches Finanzrecht - Henning Tappe - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Ausschluss der Volksgesetzgebung
Оглавление85
Volksbegehren oder Volksentscheide sind im Bereich des Finanzrechts weitgehend ausgeschlossen. Auf Bundesebene ist dies nicht weiter verwunderlich, denn hier gibt es auch sonst keinerlei direkte Entscheidung des Volkes in Sachfragen. Die demokratische Legitimation wird im Bund nur durch Wahlen (Art. 20 Abs. 2 Satz 2, 38 GG) gestiftet, die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG ebenfalls genannten Abstimmungen gibt es allein in einem Sonderfall, der Neugliederung des Bundesgebiets in Art. 29 GG[42]. Das Volk ist hier daher (nur) über die Wahl der Parlamente an der Haushalts- und Finanzgesetzgebung beteiligt.
86
Angesichts der demokratischen Bedeutung des Budgetrechts und deren Betonung durch die Verfassungsgerichte ist es allerdings durchaus erstaunlich, dass direktdemokratische Verfahren im Bereich des Finanzrechts auch dort ausgeschlossen sind, wo Plebiszite grds zulässig sind: in den Ländern und auf Gemeindeebene.
87
Im Gegensatz zum Grundgesetz sind nach allen Landesverfassungen Volksentscheide möglich[43]. Einige Bereiche werden allerdings der Volksgesetzgebung entzogen, nämlich „Finanzfragen“, „finanzwirksame Gesetze“ bzw den „Haushalt“ betreffende Vorhaben. Ein derartiger Ausschlusstatbestand findet sich in dieser oder ähnlicher Form in allen Landesverfassungen[44].
88
Solche Finanzausschlussklauseln gab es schon in der Weimarer Reichsverfassung (WRV) von 1919 und der Verfassung des Freistaats Preußen von 1920. Nach Art. 6 Abs. 3 der preußischen Verfassung waren Volksbegehren über Finanzfragen, Abgabengesetze und Besoldungsordnungen nicht zulässig. Über den Haushaltsplan, Abgabengesetze und Besoldungsordnungen konnte nach Art. 73 Abs. 4 WRV nur der Reichspräsident einen Volksentscheid veranlassen[45].
89
Begründet wird der Ausschluss v.a. der Haushalts- (vgl zB Art. 73 BayVerf) von der Volksgesetzgebung damit, dass allein das Parlament in der Lage ist, alle Einnahmen und notwendigen Ausgaben insgesamt im Blick zu haben, diese unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Vorgaben der Verfassung und des Vorbehalts des Möglichen[46] sowie eines von ihm demokratisch zu verantwortenden Gesamtkonzepts in eine sachgerechte Relation zueinander setzen kann und für den Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben sorgen muss[47].
90
Auch soll es Sinn und Zweck der Finanzausschlussklausel sein, zu verhindern, dass bestimmte Interessengruppen im Wege der Volksgesetzgebung Gesetze in eigener Sache beschließen, um sich finanzielle Sondervorteile zu verschaffen[48], dies kommt vor allem auch bei Abgabengesetzen und Besoldungsordnungen (vgl zB Art. 68 Abs. 1 Satz 4 Verf NRW; Art. 109 Abs. 3 Satz 3 RPVerf) in Betracht.
91
Zudem wird die Ausschlussklausel für erforderlich gehalten, um solche Gesetze von der Volksgesetzgebung auszunehmen, die aufgrund ihrer Komplexität ungeeignet seien, durch ein plebiszitäres „Ja“ oder „Nein“ entschieden zu werden. Gerade die finanzielle Tragweite haushaltswirksamer Gesetze sei für die Bürger kaum überschaubar[49]. Jedoch erscheint es nicht von vornherein ausgeschlossen, dass auch der Volksgesetzgeber in der Lage ist, in verantwortungsbewusster Weise Gesetze mit Auswirkungen auf den Landeshaushalt zu beschließen[50].
92
Aus dieser Argumentation leitet sich auch das Verständnis der Finanzausschlussklauseln ab, die allgemein „Finanzfragen“ ausnehmen (zB Art. 68 Abs. 1 Satz 4 Verf NRW; Art. 109 Abs. 3 Satz 3 RPVerf). Haushaltswirksame Gesetzentwürfe, die das Volk einbringt, sind davon erfasst und unzulässig, wenn sie auf den Gesamtbestand des Haushalts Einfluss nehmen, damit das Gleichgewicht des gesamten Haushalts stören, zu einer Neuordnung des Gesamtgefüges zwingen und zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Budgetrechts des Parlaments führen. Das Gleiche gilt, wenn der Schwerpunkt des Gesetzentwurfs in der Anordnung von Einnahmen oder Ausgaben liegt, die den Staatshaushalt wesentlich beeinflussen[51].
93
Vom Ausschluss der Volksgesetzgebung nach geltendem (Landes-)Verfassungsrecht zu unterscheiden ist die Frage, ob eine Ausdehnung der Volksgesetzgebung auf Finanzfragen durch eine Verfassungsänderung möglich wäre. Das HmbVerfG hat dies unter Rückgriff auf das Demokratieprinzip „in seiner Ausprägung als Grundsatz der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Parlaments“ verneint[52]. Allerdings erscheint durchaus fraglich, ob aus dem Demokratieprinzip ein solcher Vorrang der repräsentativen Demokratie abzuleiten ist[53].
94
Lösung Fall 2 (Rn 63):
Das Volksbegehren ist mit Art. 73 BayVerf nicht vereinbar, wenn es den „Staatshaushalt“ betrifft. Ob dies der Fall ist, ist durch Auslegung zu ermitteln. Der Begriff „Staatshaushalt“ umfasst nach seiner Wortbedeutung alle im Haushaltsplan ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben des Staates. Dies könnte dafür sprechen, dass nicht nur Volksbegehren über den Staatshaushalt insgesamt, sondern auch zu einzelnen Haushaltsansätzen unzulässig sind. Systematisch steht Art. 73 in enger Beziehung zu Art. 78 und 79 BayVerf. Das Recht der Budgetinitiative liegt allein bei der Staatsregierung, so dass ein Initiativrecht des Volksgesetzgebers zur Aufstellung des Haushalts insgesamt nicht in Betracht kommt. Hätte der Verfassungsgeber nur den Haushalt und das Haushaltsgesetz insgesamt von der Volksgesetzgebung ausnehmen wollen, wäre Art. 73 BayVerf rein deklaratorisch. Auch Sinn und Zweck könnten dafür sprechen, dass Volksbegehren zu einzelnen Haushaltsansätzen ausgeschlossen sein sollen. Das Parlament muss die Möglichkeit haben, im Rahmen eines Gesamtkonzepts zu entscheiden, wo jeweils die Schwerpunkte des finanziellen Engagements des Staates liegen sollen und in welcher Abstufung andere Bereiche demgegenüber zurückzutreten haben[54]. Allerdings darf mit einer solchen Auslegung nicht die grds Entscheidung des Verfassungsgebers zugunsten der Volksgesetzgebung konterkariert werden. Würde man jeden Gesetzentwurf mit finanziellen Auswirkungen unter die Finanzausschlussklauseln fassen, wäre die verfassungsrechtlich gewährleistete Volksgesetzgebung praktisch bedeutungslos[55]. Jede Sachfrage berührt den „Staatshaushalt“ iSv Art. 73 BayVerf. Die Zulässigkeit eines Volksentscheids muss daher danach beurteilt werden, welche finanziellen Auswirkungen ein Volksbegehren auf die Haushaltsplanung im Ganzen hat. Unzulässig ist ein Volksentscheid somit dann, wenn er auf den Gesamtbestand des Haushalts Einfluss nimmt, damit das Gleichgewicht des gesamten Haushalts stört, zu einer Neuordnung des Gesamtgefüges zwingt und damit zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Budgetrechts des Parlaments führt[56]. Volksentscheide, die zu geringeren Ausgaben des Staates führen und damit die Handlungsspielräume des Parlaments erweitern, sind daher zulässig[57].
95
Zu unterscheiden sind echte Plebiszite von dem auf kommunaler Ebene verbreiteten Konzept des Bürgerhaushalts[58]. Mit dem Bürgerhaushalt bieten Gemeinden ihren Einwohnern die Möglichkeit, zumeist über ein Online-Portal vor der Verabschiedung des Haushalts durch die Vertretung (Rat, dazu Rn 1070) über Einnahmen und Ausgaben mitzubestimmen[59]. Neben diesen nicht verbindlichen Befragungen gibt es auch förmliche Beteiligungsverfahren (zB § 80 Abs. 3 GO NRW). Ziel dieser Angebote ist es, das Haushaltsgeschehen transparenter zu machen und das Interesse an der Kommunalpolitik zu wecken[60].