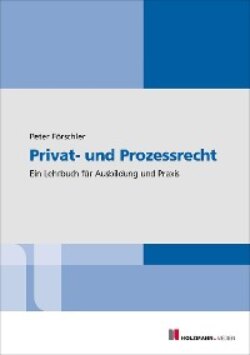Читать книгу Privat- und Prozessrecht - Peter Förschler - Страница 63
3.2.4 Das Eigentum 3.2.4.1 Begriff des Eigentums
ОглавлениеEigentum ist das umfassende Vollrecht an einer Sache. Es kann an beweglichen oder an unbeweglichen Sachen (Immobilien) bestehen. Privateigentum ist in der Bundesrepublik Deutschland als ein grundsätzlich unbeschränktes, individuelles Herrschaftsrecht anerkannt: „Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet“ (Artikel 14 Abs. 1 GG).
Der Eigentümer einer Sache kann mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen (§ 903 BGB). Der Eigentümer kann also seine Sachen nach seinem Willen gebrauchen und verbrauchen, bearbeiten, umgestalten, Nutzungen daraus ziehen, sie veräußern oder zerstören.
Diese Ausgestaltung und Garantie des Privateigentums hat nicht zu allen Zeiten und in allen Staaten gegolten. In frühgeschichtlicher Zeit (Zeit der Sippenverbände) gab es kein Einzeleigentum der Sippenmitglieder. Solches entstand erst nach und nach, zuerst an persönlichen Dingen wie Schmuck, Waffen und sehr spät erst an Grund und Boden.
Eigentum gibt es nur an Sachen (§ 90 BGB).
Es ist deshalb falsch, vom „Eigentümer eines Unternehmens“ zu reden, denn ein Gewerbebetrieb als Gesamtheit ist keine Sache. Auch gibt es kein Eigentum an einem Sparkonto. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine Forderung gegen die Bank. Der Kontoinhaber ist als Forderungsinhaber ein Gläubiger der Bank.
Schließlich gibt es auch kein Eigentum an einem Patent. Der Erfinder, für den das Patent eingetragen ist, ist Rechtsinhaber oder Berechtigter.
Jedoch ist auch in unserer Zeit das Eigentumsrecht nicht als schrankenlose Machtbefugnis zu verstehen, vielmehr besteht eine sogenannte Sozialbindung des Privateigentums: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ (Art. 14 Abs. 2 GG).
So hat selbstverständlich der Eigentümer für den sicheren Zustand seiner Sachen zu sorgen, damit andere dadurch nicht Schaden erleiden (vgl. § 836 BGB für den „Grundstücksbesitzer“). Am deutlichsten zeigt sich die soziale Bindung des Eigentums im Wohnungsmietrecht bei den dort stark eingeschränkten Kündigungsmöglichkeiten (vgl. §§ 573 ff. BGB). Weitere Einschränkungen ergeben sich unter den Gesichtspunkten des Nachbarrechts (z. B. §§ 906 ff. BGB), des öffentlichen Baurechts (Erfordernis einer Baugenehmigung), des Landwirtschaftsrechts (Veräußerungsbeschränkungen bei landwirtschaftlichen Grundstücken) sowie des Natur- und Denkmalschutzes. Wenn es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, kann sogar eine Enteignung des Privateigentums erfolgen (z. B. für Zwecke des öffentlichen Straßenbaus). Aus der Sozialbindung des Eigentums wird auch die Corporate Social Responsibility (CSR) von Unternehmen abgeleitet.