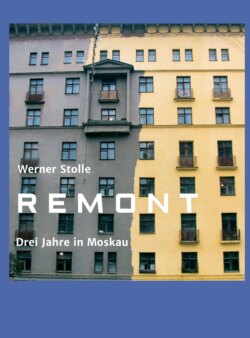Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErste Annäherung
8. Januar – 31. Januar 1990
Das Schanghai-Virus hat in der Sowjetunion eine Grippewelle ausgelöst. Allein in Moskau sollen sich täglich angeblich 30 000 Menschen damit anstecken. Deshalb sind die Schulferien für die Einheimischen um eine Woche verlängert worden. Unsere Russischlehrerin Irina weiß, wie man sich richtig schützt: durch Vitamine und konsequentes Meiden von Menschenansammlungen aller Art. Am besten geht man nicht einmal zum Einkaufen.
Nach einem rapiden Temperatursturz von minus 1 auf minus 20 Grad an einem Tag beobachten wir, wie Lkw-Fahrer unter ihren Fahrzeugen Feuerchen entfachen, damit der Motor auftaut und hoffentlich wieder anspringt. Bei extremem Dauerfrost ist es üblich, die Motoren rund um die Uhr laufen zu lassen, um solche lästigen Feuer zu vermeiden. Waghalsige Abschlepp-Manöver liegengebliebener Autos nehmen massiv zu. In der Wawilowa schlägt ein Fremdstartversuch fehl. Der Fahrer ist frustriert. Sein erst zehn Jahre alter Lada will nicht mehr. Sein nächstes Auto soll ein Mercedes sein. Deshalb fragt er mich, was man denn so investieren müsse. Nach meiner Antwort sieht man förmlich, wie der gute Mann vor Schreck erstarrt. Einen Tag später sehe ich von weitem, dass er seinen Lada von einem Kumpel abschleppen lassen will. Das Seil ist schon in den Haken unter der vorderen Stoßstange eingeklinkt. Ein letzter Fremdstartversuch wird unternommen, und tatsächlich springt der Motor an. Dankbares Händeschütteln, beide steigen in ihre Fahrzeuge. Die Motorhaube des Ladas konnte auf die Schnelle nicht komplett geschlossen werden, weil das andere Ende des Abschleppseils, das ja wider Erwarten nicht mehr zum Einsatz kam, im Motorraum abgelegt wurde. Es ist zu kalt, um noch einmal auszusteigen, um das Seil vom Haken und aus dem Motorraum zu entfernen. So schleift es nun eine Zeitlang über Moskaus Straßen.
Wir nutzen die Kälte und fahren Schlittschuh im Gorki-Park. Inzwischen konnten wir in einem Sportgeschäft am Leninskij das restliche Zubehör für die Langlaufskier der Kinder ergattern, so dass sie ihre ersten Laufversuche hinter unserem Haus machen können. Außerdem spielt Ingmar im Hinterhof mit seinen zahlreichen Freunden Eishockey. Dafür wurde extra eine größere Fläche freigeräumt und unter Wasser gesetzt. Man verständigt sich mit einem Gemisch aus Englisch, Französisch und Russisch.
Zwei zentrale Probleme beunruhigen die Menschen. Erstens die anwachsenden innenpolitischen Konflikte sowie das zunehmende Aufbegehren der Demonstranten im Baltikum und der Bürgerkrieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Zweitens ein Erlass von Michail Gorbatschow zur Begrenzung des Alkoholkonsums. Der Grund liegt auf der Hand. Laut Statistik hat der Konsum, besonders von harten Sachen, im vergangenen Jahr um 33 Prozent zugelegt. Ursachen für diesen Trend seien nach einer Umfrage des Innenministeriums niedrige kulturelle Bedürfnisse der Menschen, ein schlechtes Freizeitangebot, soziale Spannungen sowie Ziel- und Perspektivlosigkeit. Ohne Glasnost wären solche Ergebnisse nicht veröffentlicht worden. Ab dem Nachmittag darf Alkohol zum Verkauf angeboten werden. Mehr als eine Flasche pro Person, und dies nur gegen Abgabe einer Pfandflasche, dürfen die Verkäuferinnen nicht aushändigen. An den Leninbergen soll es schon Razzien gegeben haben. Mit so einer Maßnahme macht sich niemand beliebt. Sie wird die Menschen mehr beschäftigen als andere Probleme.
Heute Abend sind wir zum Gegenbesuch in kleiner Runde in die DDR-Schule eingeladen. Wir sind die ersten bundesdeutschen Gäste, die dieses Gebäude seit der Schulgründung betreten dürfen. In der Eingangshalle stehen Büsten von Lenin und Thälmann, die, wie wir später erfahren, angeblich auf Wunsch der Schülerinnen und Schüler demnächst entfernt werden sollen. Die Atmosphäre ist freundlich und deutlich entspannter als Ende Dezember bei uns. Zuerst erhalten wir eine Führung durch ein kleines Areal der Schule. Einige Projekte, die in Schaukästen ausgestellt sind, werden vorgestellt und einige Fachräume gezeigt, deren Ausstattung uns beeindruckt. Sozialistische Parolen und Devotionalien sehen wir nicht. Auch keinen weiteren Lenin.
Man sei sehr neugierig, wie bei uns der Unterricht ablaufe und wolle unbedingt demokratische Unterrichtsformen kennen lernen und ausprobieren. Es habe schon Veränderungen an dieser Schule gegeben. So seien bereits Englisch und Französisch in die Stundentafel aufgenommen worden. Schnell sind wir bei der aktuellen politischen Lage. Den Mauerfall und die Grenzöffnungen bewerten die DDR-Kollegen grundsätzlich positiv. Man schmiedet eifrig Pläne, in den Westen zu fahren, nachdem die Volkskammer ein neues Reisegesetz verabschiedet hat: Reisefreiheit für alle.
Auf die Zeit vor der Wende angesprochen, zitiert eine der Kolleginnen ihren Schulleiter: „Berührungsängste hatten wir nie. Wir durften aber keinen Kontakt haben“. Der Schulleiter selbst ist nicht anwesend.
Nach vier anregenden Stunden verabschieden wir uns herzlich voneinander. Lange noch denke ich über diese Begegnung nach.
Frau Hartmann, die hin und wieder freiwillig Alkohol- und Drogensüchtige in einem Moskauer Krankenhaus betreut, hat den akuten Mangel an medizinisch-technischem Gerät vor Ort erlebt. Durch eine irrtümlich zu stark dosierte Anästhesie bekam ein Patient Atembeschwerden. Der Arzt riet den Angehörigen, im Kinderkaufhaus Djetskij Mir aufblasbare Gummitierchen zu kaufen, mit deren Hilfe die Atmung des Kranken gekräftigt werden könne. Eine traurige Geschichte für eine Weltmacht, die Kosmonauten in den Orbit schickt.
Hellmuth, unser Hobbykoch, löst beim Essen einen regionalen Sprachenstreit aus. Alles beginnt mit der allgemeinen Beurteilung des russischen Schwarzbrotes. Es gibt nur eine einzige Sorte in den staatlichen Bäckereien: ein hellschwarzes, von der Konsistenz her eher weiches, mit Koriander gewürztes Brot, dass nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist. Schleswig-Holstein kennt nur die Begriffe Schwarzbrot, Mischbrot und Weißbrot. Eindeutiger kann man es nicht formulieren. In Bayern, sagt Hellmuth, gebe es hingegen nur Schwarzbrot oder Weißbrot, ein Mischbrot, das eigentlich ein Graubrot sei, zähle in Bayern zu den Schwarzbroten. Ein Mischbrot könne kein Graubrot sein, wendet Eric ein, weil es von der Farbe her braun ist, somit auch kein Schwarzbrot. Der Begriff Graubrot sei irreführend, die Bezeichnung Braunbrot habe sich nicht durchgesetzt. Die Frage, warum in Bayern das Mischbrot dem Schwarzbrot und nicht dem Weißbrot untergeordnet ist, bleibt ungeklärt. Und übrigens eröffnet McDonald’s in der Gorkowo Ulitsa, Ecke Puschkinplatz, seine erste Filiale in einem sozialistischen Land. Da heißt alles, was mit Brot zu tun hat, ganz einfach Burger.
In die Packbier-Wohnungssache kommt Bewegung. Herr Packbier konnte Ende des vergangenen Jahres endlich umziehen. Er hat uns einen Wohnungsschlüssel überlassen. Hoffentlich bekommt das UPDK davon keinen Wind. Wir nutzen die leeren Räume illegal, damit Ingmar und sein Freund Felix mit ihrer halben Klasse ihre Geburtstage nachfeiern können.
Am letzten Tag des Monats erscheint ein vierköpfiges UPDK-Kollektiv zur Begutachtung der Packbierwohnung. Wir dürfen mit. Man misst einiges aus, notiert sich, was alles renoviert werden muss. Man klopft gegen die Wand, die für den Durchbruch bestimmt ist und nickt. Es geht los. Irgendwann.