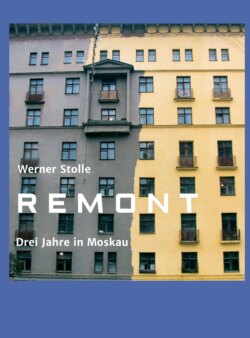Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 41
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWindstärke 11
9. April – 12. April 1990
Heidi teilt mir das Ergebnis einer internen Abstimmung mit, von der ich aus unerfindlichen Gründen ausgeschlossen wurde. Ab sofort gilt: Es werden nur noch asphaltierte Straßen befahren. Einverstanden. Demokratie geht vor Eigensinn!
Kalkan heißt unser nächster Zielort. Dieter hat uns das Hotel Pirat empfohlen. Nach einiger Zeit fordert Heidi einen Zwischenstopp. Sie durchwühlt unser Gepäck und stellt fest, dass ihre Jacke wohl noch im Kleiderschrank unserer Hütte hängt. Die hole ich ihr natürlich gerne. Schon bald finde ich ein idyllisches Plätzchen, wo ich die drei absetzen kann, eine römische Brückenruine, deren eine Hälfte bis zur Flussmitte ragt, Einzelteile der andere Hälfte ragen aus dem Wasser. Die Kinder entdecken Schildkröten und schlangenähnlichen Wasserwesen. Sie freuen sich über diese unverhoffte Pause. Ich nehme den direkten Weg zurück zum Bafa-See und halte mich brav an unsere Abmachung. Gute zwei Stunden später bin ich mit der Jacke wieder zurück und treffe auf meine ausgeruhte Familie.
Den Ort Datça müssen wir aus zeitlichen Gründen rechts liegen lassen. Aber in dem verschlafenen Nest Ortaca, östlich des Köyceğiz-Sees, halten wir vor einer Bank, um uns mit einer weiteren Million Lire einzudecken. Der Apfeltee während der Wartezeit tut gut. In einem Café, wo niemand sitzt, fragen wir nach, ob überhaupt geöffnet sei. Sofort kommt Leben in die Bude. Zwei sympathische junge Männer, der Ähnlichkeit nach scheinbar Brüder, schmeißen hier den Laden. Wir sollten doch lieber am Stammtisch Platz nehmen als draußen an der staubigen Straße. Die Sitzgelegenheiten entpuppen sich als ein Haufen Ziegelsteine, die zu einer Bank aufgestapelt und mit Teppichen gepolstert sind. Sie fordern uns auf, aus einer Reihe Kassetten unsere Lieblingsmusik auszuwählen. Dann tischen sie uns Schokoladentorte auf. Sie verabschieden uns wie alte Bekannte.
Die 150 Kilometer lange, bergige Etappe von Ortaca über Fethiye nach Kalkan nimmt einige Zeit in Anspruch. Immer wieder halten wir an Aussichtspunkten auf den Passstraßen an, um die sagenhafte Aussicht auf das Meer oder die über 3000 Meter hohen, schneebedeckten Berge des Akdaği-Massivs zu genießen und Fotos zu schießen. Uns fällt bei dieser beschaulichen Fahrt auf, dass in den fruchtbaren Tälern ausschließlich Frauen die Feldarbeit verrichten, beaufsichtigt von einem Mann, der meist lässig auf einem Eselkarren herumlümmelt. Wir begegnen auch vielen Viehtreiberinnen und etlichen Frauen, die schwere Lasten schleppen. Gleichzeitig fällt uns auf, dass die Cafés in den Dörfern nur von Männern bevölkert werden, die Mah-Jongg oder Domino spielen oder sich ihre Zeit an schattigen Plätzen beim Plausch vertreiben.
Leider liegen wieder einige Spekulantenruinen an den Berghängen, als wir uns Kalkan nähern. Der kleine Ort mit seinen üppigen Terrassengärten klebt so am Berghang, dass jeder Spaziergang einer kleinen Kletterpartie gleicht. Die vielen Hotels zeugen davon, dass hier während der Hauptsaison die Hölle los sein muss. Zu dieser Zeit ist es noch überall ruhig, auch im Restaurant an der kleinen Bucht, wo wir uns jetzt zum Fischessen niedergelassen haben. Draußen wird es schnell unangenehm kühl. Die Zimmer im Hotel Pirat sind so kalt, dass wir uns mit Wolldecken eindecken.
Am Strand von Patara peitscht uns ein Sturm den feinen Sand in die Augen, die Haare, die Ohren. Wie Nadelstiche fühlt es sich an, wenn die Sandkörner auf unbedeckte Körperteile treffen, so als würde man perforiert. Nirgendwo finden wir eine Düne, die uns schützen kann. Die wenigen Touristen flüchten in das Strandrestaurant, nehmen einen kleinen Imbiss in der Hoffnung, der Sturm würde sich bald legen. Die halbhohen gläsernen Schutzwände halten immerhin so viel Wind ab, dass wenigstens unser Essen nicht völlig einsandet. Speisekarten, Tischsets, Papierservietten und andere leichte Gegenstände fliegen uns um die Ohren. Mit jeder Bö prasselt eine Ladung Sand gegen die Glaswände. Draußen gehen erste Blumenkübel zu Bruch. Der einzige windgeschützte, stille Ort ist die französische Toilette. Hier möchte man sich dennoch nicht länger als nötig aufhalten. Nur wenige Schritte hinter dem Restaurant beginnt das antike Patara, ein bisher wenig erschlossenes Gelände. Kein Zaun, kein Wächter, kein Kassenhäuschen. Auch hier heult der Sturm. Kein Wunder, dass das gut erhaltene Theater und die Ruinen der griechisch-römischen Stadt immer mehr unter Sanddünen verschwinden. Das, was man noch sieht, ist wild überwuchert. Schafe weiden auf antikem Grund. Vielleicht sehen wir auch deswegen wenig von der Anlage, weil unsere Augen voller Sand sind.
Unsere Laune wird nicht wesentlich besser, als Annika auf der Rückfahrt die Fensterkurbel abbricht und die Fensterscheibe in der Türfüllung verschwindet. Das ist nicht so günstig, weil uns sofort der Wind wieder angreift. Von nun an sehen wir die Umgebung mit ganz anderen Augen. Wir sind weniger auf die Schönheiten der Landschaft fixiert als auf eine Reparaturwerkstatt. Das Dorf Yeniköl ist unsere Rettung. Vor einer einsturzgefährdeten Garage, in der Unmengen von Autoersatzteilen und Reifen scheinbar chaotisch kreuz und quer verstreut liegen, halte ich an. Ich traue mich nicht, meine Scheibe herunterzukurbeln, um dem jungen Mechaniker, der auf uns zu eilt, unser Anliegen vorzutragen. Dazu steige ich lieber aus und deute mit dem Finger auf den Fensterspalt mit der versenkten Scheibe. Dabei imitiere ich mit der anderen Hand fachmännisch eine Kurbelbewegung. Der junge Mechaniker signalisiert, dass er sofort verstanden hat und bedeutet uns, wir sollten ein bisschen spazieren gehen. Apfeltee bietet er uns nicht an. Stattdessen schwingt er sich auf sein Motorrad, das an der Garagenwand lehnte und braust davon. Die Garage steht noch. Sekunden später erstirbt das sonore Geräusch seiner Maschine. Wir sehen unseren Mechaniker etwa 150 Meter von uns entfernt absteigen und die Pforte zu einem Steinhaus öffnen. Wahrscheinlich muss er vorher eine kleine Mahlzeit einnehmen, damit er die Kraft hat, die Reparatur durchzuhalten. Beschämt stelle ich fest, dass ich die Arbeitsmoral türkischer Automechaniker total unterschätzt habe. Wenige Sekunden später lehnt das Motorrad wieder an der Garage, gibt ihr den Halt, den sie benötigt, um nicht abzusacken. Mit einer neuen Kurbel in der Hand macht sich unser Mann an die Arbeit, nicht ohne uns vorher noch einen freundlichen Blick zuzuwerfen, dem ein gewisser Stolz innewohnt.
Als wir am Abend in Kalkan wieder unser Restaurant in der kleinen Bucht aufsuchen wollen, hat der Sturm sich zum Orkan entwickelt. Vor unserem Hotel sind schon eine Lagerhalle abgedeckt und eine Pergola zerfetzt worden. Deren Einzelteile heben nach jeder Bö aufs Neue ab, um kurz darauf bergab zu poltern. Schutzhelme wären jetzt nicht schlecht. Wir kämpfen uns bis zur Bucht durch. An der Strandpromenade schleudert uns der Sturm eine Ladung Sand entgegen. Draußen sitzt heute niemand.
Im sicheren, sturmgeschützten Restaurant dauert es eine Weile, bis wir die Speisekarte entziffern können, weil uns der Sand in den Augen zu schaffen macht. Am Nebentisch sitzt eine kleine deutsche Touristengruppe, die einen Segeltörn gebucht hat, der morgen früh beginnt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde beginnt ein heiteres Beruferaten, an dem Heidi und ich außer Konkurrenz heimlich teilnehmen.
Zwischen Mitternacht und zwei Uhr tobt der Orkan so stark, dass man das Gefühl hat, das Hotel würde aus den Angeln gehoben. Die Böen drücken gegen die Fenster und die Balkontür; es knackt und ächzt bedenklich. Von einem Bauzelt steht nur noch das Eisengerippe; Dachziegel zerplatzen auf der Straße. Blitze erhellen die Szenerie. Vielleicht ist es auch Wetterleuchten, denn Donner und Regen bleiben aus. Das Hotel hält dem Unwetter stand.
Am Morgen ist es endlich windstill. Das dreigeschossige Gebäude neben dem Hotel hat arg gelitten. Das Dach ist abgedeckt. Auf der Straße liegt Schutt. Man sagt uns, der Sturm habe Windstärke 11 gehabt. Unser Auto ist unversehrt geblieben, aber mit einer dichten Schmutzschicht überzogen. Dieser ganze Dreck hätte sich auch im Wageninneren breitgemacht, wenn es in der Peripherie von Kalkan an Fensterkurbeln gemangelt hätte.
An der Tankstelle sieht man schon am Blick des Tankwarts, dass er lieber sauberere Fahrzeuge als unseres befüllen würde. Mit spitzen Fingern dreht er den Tankverschluss auf und hängt den Schlauch ein. Dann schnappt er sich einen Eimer Wasser und beginnt unser Auto unaufgefordert zu waschen. Ich denke unwillkürlich an Sergej. Am Ende dieser spontanen Reinigungsaktion hellt sich sein Blick deutlich auf. Marlboro haben wir nicht dabei. Aber der fleißige Tankwart ist auch mit unserem Trinkgeld zufrieden. Wir sind begeistert von der spontanen türkischen Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft. Kein Vergleich zu der Servicewüste Moskau.
Wir kosten die Ruhe nach dem Sturm zuerst in der Hafenstadt Kaş aus und anschließend in einer winzigen Felsenbucht mit kleinem Sandstrand. Niemand klettert während der nächsten zwei Stunden über die Felsen zu uns herunter. Wir sind allein. Das Wasser ist allerdings so kalt, dass man es höchstens eine Minute darin aushält. Nach so einem Kurzbad hat man aber das Gefühl, endlich die letzten Sandkörner vom Körper gespült zu haben.
Einen Tag später brechen wir auf Richtung Antalya. Dieter hat uns abseits des Massentourismus eine Unterkunft vorgeschlagen. Die Fahrt entlang der Südküste über spektakuläre Passstraßen, durch Wälder, über Flüsse ist so schön, dass man lieber in dieser Gegend als in Antalya Station machen möchte. Aber wir wollen erst in Demre anhalten, um uns die lykischen Felsengräber und das Amphitheater der antiken Stadt Myra anzusehen. Das Gebiet um Demre schreckt uns ab. Kilometerweit erstrecken sich Treibhäuser und Felder, die mit Plastikplanen abgedeckt sind. Durch den Sturm haben sich Unmengen von großen Plastikteilen losgerissen und die Landschaft zusätzlich verschandelt. Wir überlegen, ob wir nach dem Rundgang durch Myra noch die Basilika des Bischoffs Nikolaus aufsuchen sollen. Aber je dichter wir uns dieser berühmten Touristenattraktion nähern, desto mehr nervt uns der Nikolausrummel in den Kiosken am Straßenrand. Als wir den Busparkplatz neben der Kirche sehen, wenden wir und verlassen Demre.
In Kumluca kommen wir direkt an einer geöffneten Bank vorbei. Einige hunderttausend Lire sind schon wieder ausgegeben worden. Wir brauchen also Nachschub. Es sollte nicht die einzige Bank bleiben, die ich ohne ein frisches Bündel Lire verlassen muss. Die Angestellten bleiben stets freundlich und ausgeglichen, haben aber überhaupt nichts den Computern entgegenzusetzen, die sich einfach weigern, den letzten Arbeitsschritt zu bestätigen, der für eine Barauszahlung notwendig ist. Nach einer halben Stunde gebe ich auf, zumal es nicht einmal Apfeltee gibt. Den gibt es in den folgenden drei Bankfilialen auch nicht. Genauso wenig wie Geld. Wahrscheinlich hat eine Orkanbö das Computersystem aller Banken von Kumluca lahmgelegt.
Als wir uns Antalya nähern, tauchen unzählige Neubauruinen von Hotel- und Appartementanlagen in den Vororten auf, die auf andere Weise als in Demre die Landschaft zerstören. Während wir uns dem Zentrum nähern, scheint es, die Stadt würde ausschließlich aus Hotels und Appartements bestehen. Überall auf Transparenten Willkommensgrüße auf Deutsch, deutsche Restaurants, Wurstbuden und Bars mit lustigen deutschen Namen, deutschsprachige Beschilderung, überall Deutsche. Bald werden es noch mehr sein, denke ich angesichts der neu gewonnenen Reisefreiheit unserer DDR-Bürgerinnen und -Bürger. Das wird der Bautätigkeit noch einmal einen kräftigen Schub verschaffen. Wir vertreten uns ein Stündchen die Beine und tauschen Geld. Computerprobleme gibt es hier nicht. Wir haben keine Lust, uns durch die verstopften Straßen bis zu Dieters Hotel durchzukämpfen und beschließen, so lange auf der Küstenstraße weiterzufahren, bis wir ein Hotel am Strand finden, das uns auf Anhieb gefällt. In Side werden wir fündig, aber die beiden Hotels, in denen wir um Zimmer betteln, sind restlos ausgebucht. Die nächste Stadt liegt knapp fünfzig Kilometer weiter im Osten: Alanya.
Alanya macht auf uns einen etwas ruhigeren und nicht ganz so touristischen Eindruck. Es ist schon dunkel, so dass wir erst einmal in einem unscheinbaren Hotel am Strand, aber auch nahe der Hauptverkehrsstraße, Quartier beziehen, in der Hoffnung, das Brandungsgetöse werde die Straßengeräusche überdecken. In unserem Zimmer ist tatsächlich nur ein Rauschen zu vernehmen. Das kommt jedoch nicht von draußen, sondern aus dem Bad, wo die Spülung ohne Unterlass läuft. Ich bin wenig motiviert, mich um diese Uhrzeit mit einem türkischen Schwimmer auseinanderzusetzen. Außerdem ist eine Neonröhre defekt, eine andere verfällt nach dem Druck auf den Lichtschalter in unregelmäßige Zuckungen. Die Sonnenkollektoren müssten auch mal erneuert werden. Sie haben nicht mehr die Kraft, das Wasser genügend zu erhitzen.
Das Einzige, das uns beim Abendessen stört, sind die wilden Schießereien, die fast in Originallautstärke aus dem Fernsehgerät schallen, auf dem ein amerikanischer Western mit original türkischem Untertitel ausgestrahlt wird.
Der Chef, der in Istanbul lebt und hier Saisonarbeit verrichtet, will sich für uns nach einem ruhigen, schöner gelegenen Hotel umhören. Wir loben ihn wegen seiner guten Deutschkenntnisse. Wie auf Knopfdruck gibt er uns Kostproben weiterer Sprachen, formuliert Sätze auf Finnisch und sogar Japanisch. Den Inhalt dieser Sätze können wir nicht überprüfen, aber Aussprache und Satzmelodie wirken überzeugend. Auf die Frage der Kinder, ob er auch Russisch spreche, reagiert er verblüfft und muss passen. Der Chef wechselt das Thema. Er schimpft über das rückständige Schulsystem in der Türkei, das nur sechs Pflichtschuljahre vorschreibt. Das Leben vieler Kinder sei sehr hart. Sie müssten in vielen Familien, nicht nur, wo Armut und Arbeitslosigkeit herrschen, nach der Schule Geld heranschaffen. Prügel gehörten zur Erziehung, gerade dann, wenn die Kinder zu wenig am Abend nach Hause brächten. Deshalb hätten die Türken auch eine so niedrige Lebenserwartung. Als er spürt, wie betroffen Annika und Ingmar reagieren, wendet er sich an sie und sagt: „Ihr solltet jeden Tag glücklich sein über eure Familie, eure Kleidung, das Reisen und dass ihr euch keine Geldsorgen machen müsst.“
Am Nebentisch liest ein Wahrsager einem deutschen Pärchen die Zukunft aus dem Kaffeesatz. Der Chef sagt auch dazu gleich seine Meinung. Er habe mehrfach selbst erlebt, wie Dorfweise, die mithilfe des Korans und arabischer Traditionsmythen die Gabe des Sehens erlernt hätten, unbekannten Kunden nicht nur die Zukunft vorhergesagt, sondern auch deren Namen und Vergangenheit „ersehen“ hätten. Er findet das Ganze unheimlich, glaubt aber daran. Die beiden Deutschen sind mit ihrer Zukunftsprognose – Glück, Heirat, Reisen, Reichtum – zufrieden, glauben aber nicht daran.