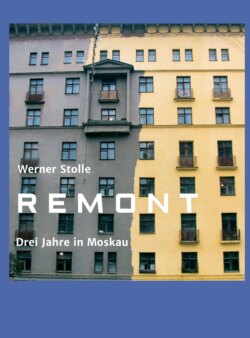Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 38
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGebremste Euphorie
16. März – 21. März 1990
Stäbchenparkett sieht gut aus und ist sehr strapazierfähig. Unsere Wohnung ist damit verlegt, mit Ausnahme der Nasszellen und der Küche, in denen Linoleumböden liegen. Es gibt zwei Faktoren, die die Lebensdauer so eines Parketts verkürzen. Zum einen gibt es in der Wohnung keinen ebenen, geraden Boden. Von Wand zu Wand kann das Gefälle in den einzelnen Räumen durchaus einige Zentimeter ausmachen. Das löst einen Domino-Effekt aus. Durch die Unebenheiten des schlecht verlegten Estrichs entstehen kleine Bodenwellen. Wenn dann das Parkett einfach draufgepackt wird, entstehen wiederum kleine Höhenunterschiede zwischen den einzelnen verlegten Parkettelementen, die man eigentlich wegschleifen müsste. Die kleinen Bodenwellen verursachen Spannungen im Parkett, die dazu führen, dass sich an einigen Stellen die Höhenunterschiede vergrößern und an anderen Stellen das Parkett absackt. Der zweite Faktor ist die Trockenheit. Durch sie lösen sich des Öfteren die Parkettstäbchen und verwandeln sich in tückische Stolperfallen. Das Aufstellen größerer Möbelstücke erfordert Filigranarbeit. Es kann einen manchmal an den Rand der Verzweiflung bringen, bis man den richtigen, sicheren Standort findet und das Möbel mit Holzkeilen oder Pappstücken so ausgerichtet hat, dass Türen und Schubladen sich einwandfrei öffnen und schließen lassen. Diese ganze Arbeit haben wir nun hinter uns.
Dass die Wände schief sind, muss nicht extra erwähnt werden.
Ursprünglich war ja geplant, dass wir am Prospekt Vernadskowo einziehen sollten. In dem Haus, das wir bei der Wohnungsbesichtigung kennengelernt hatten, hat sich eine Gangsterstory zugetragen. Zwei Männer, die sich als UPDK-Angestellte ausgaben, klingelten an einer Wohnungstür. Sie hätten den Auftrag, die Wohnung zu inspizieren. Tage später kamen drei andere Männer, um eine angeblich defekte Telefonleitung zu reparieren. Nur ein kleiner Junge war zu Hause. Kaum in der Wohnung, zog einer der Männer eine Pistole und hielt sie dem Kleinen an die Schläfe. Die beiden anderen räumten die Wohnung aus. Als die Polizei erschien, traf sie nur noch den verängstigten Jungen an. Die Räuber waren längst über alle Berge.
Für den 18. März haben wir uns mit Gisela und Eric im Slawianskij Basar, in einer Nebenstraße des GUM im Stadtteil Kitaigorod, zum Essen angemeldet. Wir dürfen an dem für uns reservierten, reichgedeckten Tisch auf der Empore dieses berühmten Restaurants aus der vorrevolutionären Zeit Platz nehmen. Von hier aus haben wir das ganze Untergeschoss im Blick, das wie eine große Halle konstruiert ist, in deren Mitte eine Tanzfläche liegt. Auf einer kleinen Bühne neben der Tanzfläche läuft schon das Abendprogramm. Wir bekommen vor folkloristischer Kulisse ein Feuerwerk russischer Volkskunst präsentiert. Von drei Musikern begleitet, führen fünf Männer und eine Frau, alle in volkstümlicher Kleidung, Tänze und akrobatische Kunststücke vor. Einer der Männer jongliert mit sechs Hula-Hoop-Reifen. Ein anderer türmt kleinkindgroße Matrjoschkas auf seinem Kopf auf. Die Varieté-Show zieht uns so in den Bann, dass das Essen fast zur Nebensache wird. Die Pilz-Julienne jedoch wird uns als Leckerbissen in Erinnerung bleiben. Wir vergessen nachzufragen, wo die Pilze denn geerntet worden seien. Das Wort Tschernobyl verkneifen wir uns heute Abend.
Als wir unsere winzigen handgeschriebenen Garderoben-Zettel abgeben wollen, tauchen aus dem Halbdunkel zwei Männer auf. Der eine zieht eine Kaviardose aus der Jackentasche, der andere entblößt seinen linken Unterarm und präsentiert uns eine kleine Auswahl russischer Armee-Uhren. Obwohl wir auf diesen kleinen Schwarzhandel dankend verzichten, händigen uns die Garderobenfrauen anstandslos unsere Jacken aus.
In der Nacht schalte ich am Weltempfänger die Deutsche Welle ein, weil mich die Ergebnisse der ersten demokratisch durchgeführten Volkskammerwahl interessieren. Über die Ergebnisse sind wir nicht so begeistert. Am Tag darauf wissen wir, wie im DDR-Compound gewählt wurde. Die überwältigende Mehrheit von 90 Prozent hat für die PDS gestimmt. Das ist nicht gerade das, was man sich gewünscht hat.
Heute Nachmittag fährt uns Igor mit dem Schulbus zur DDR-Schule am Prospekt Vernadskowo. Die acht Schülerinnen und Schüler meiner achten Klasse und ich sind etwas aufgeregt. Wir sind die ersten aus der BRD, die diese Schule betreten dürfen. Es ist schon dämmerig, als ein Milimann uns die Schranke am Eingang zum DDR-Compound hochdrückt und unseren Bus passieren lässt. Zwei Lehrerinnen begrüßen uns, als wir aussteigen. Sie führen uns über den Schulhof, auf dem ich mit Kreide aufgemalte Anti-Kohl-Parolen entdecke, dann durch die Eingangshalle, in der die Büsten von Lenin und Thälmann immer noch auf ihren Abtransport warten, über die Flure in einen Klassenraum, in dem uns ungefähr 25 Schülerinnen und Schüler einer achten Klasse erwarten. Die Atmosphäre ist angespannt, die Befangenheit auf beiden Seiten deutlich zu spüren. Auf den einzelnen Tischgruppen stehen Tee und Kuchen. Wir stehen mit unseren Gastgeschenken, darunter etliche Aufkleber mit unserem Schullogo, noch etwas verloren zwischen Tafel und Tischgruppen. Nach der sehr formal gehaltenen, fast steifen Begrüßungszeremonie sowie den gegenseitigen Vorstellungen und Dankeswortn sage ich ein paar Sätze über unsere Schule und die Klassensprecherin Mona etwas über die Klasse. Der genaue Ablauf des Nachmittags ist festgelegt und wird allen mitgeteilt.
Punkt eins ist das gegenseitige Kennenlernen mit Platzwechsel, was ja auch wirklich Sinn macht. Danach verteilen die Lehrerinnen meine Achtklässler auf die freien Plätze. Ich darf am Lehrertisch Platz nehmen. Die beiden Kolleginnen, denen ich heute das erste Mal begegne, bleiben auf Distanz. Über ein oberflächliches Geplauder kommen wir nicht hinaus. Die beiden behalten die ganze Zeit ihrer eigenen Schülerinnen und Schüler im Blick. Vielleicht haben sie ja bestimmte Anweisungen von ihrem Chef erhalten, der auch heute nicht anwesend ist.
Zur Auflockerung (Punkt zwei) erhalten wir eine kleine Führung mit kurzen Erläuterungen, wie damals schon unser Kollegium. Die beiden Klassen sind dabei mehr mit sich selbst beschäftigt. Sie lassen diesen Programmpunkt höflich über sich ergehen. Mein Eindruck ist, dass die DDR-Schüler die Annäherung der beiden Staaten enthusiastischer sehen als ihre beiden Lehrerinnen.
Punkt drei: Ausklang im Klassenraum und im Flur. Die Schülerinnen und Schüler tauschen Adressen aus und vereinbaren erste Treffen. Das freut uns drei. Im Bus wird diskutiert, warum man ganz bestimmte Räumlichkeiten auf keinen Fall betreten durfte.
Igor wirkt am nächsten Tag noch wortkarger als sonst. Als ich ihn aufheitern will, erzählt er mir, dass gestern Abend sein kleiner Neffe gestorben sei. Ein anderer Junge hatte ihm einige Tage zuvor einen vereisten Schneeball an den Kopf geworfen. Der Kleine habe das Bewusstsein verloren und sei ins Krankenhaus gefahren worden. Die Diagnose der Ärzte: eine Gehirnblutung.